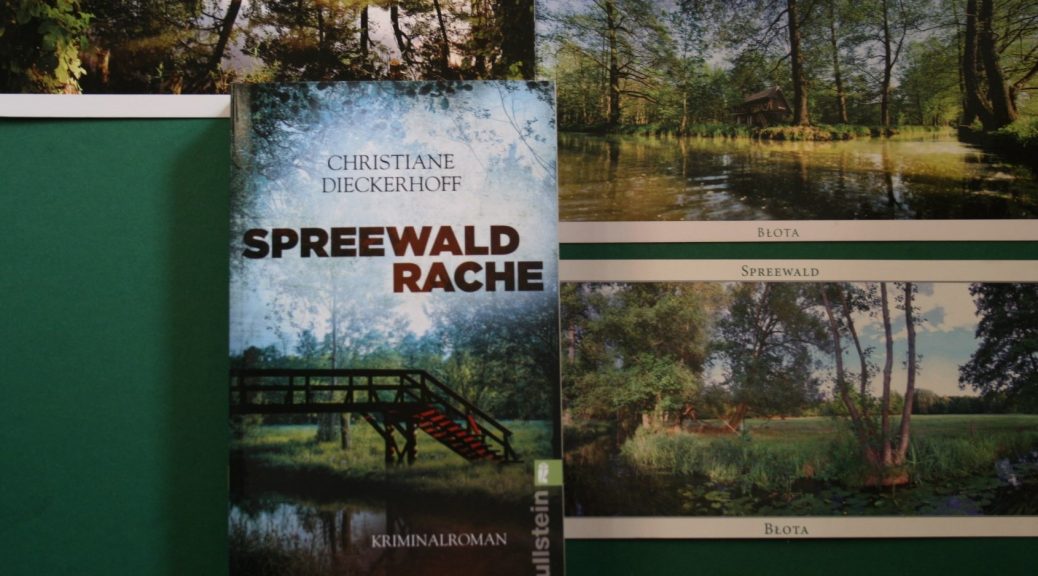Sir Arthur Conan Doyle | Eine Studie in Scharlachrot
Klassischer Detektivroman aus dem Jahre 1881
„Ich muss ihnen für alles danken. Ohne sie wäre ich vielleicht nicht hingefahren und hätte so die beste Studie verpasst, die mir je untergekommen ist: Eine Studie in Scharlachrot, eh? Warum sollten wir nicht ein wenig Kunstjargon verwenden? Der scharlachrote Faden des Mordes verläuft durch das farblose Knäuel des Lebens, und unsere Pflicht ist es, ihn zu entwirren, zu isolieren und jeden Zoll davon bloßzulegen.“ *
Der Meister selbst also ist für den Titel des Romans verantwortlich, der über den allerersten Fall von Sherlock Holmes und Doktor Watson berichtet und im November 1887 den Lesern eines Londoner Magazins das ungewöhnliche Gespann bekannt macht, Beeton’s Christmas Annual. Erst ein Jahr später erscheint die Geschichte dann auch in Buchform beim Verlag Ward, Lock & Co., noch ohne großen Zuspruch. Zugegeben, es ist auch ein eher schwächerer erster Auftritt des gegensätzlichen Duos, welches bald darauf – und bis heute! – die Kriminalliteratur verändern und beeinflussen sollte. Insofern ist dieses Debüt natürlich von hohem Interesse für jeden Liebhaber des Sherlock-Holmes-Kanons, erleben wir doch hier das erste Treffen der Gefährten, den Beginn einer ungewöhnlichen und folgenreichen Beziehung.
Der junge Mediziner Dr. John H. Watson ist gerade aus Afghanistan zurückgekehrt, wo er als Assistenzarzt im Krieg gearbeitet hat und schwer verwundet wurde. Gesundheitlich angeschlagen, kehrt er zur Erholung nach London zurück, wo er nun eine preiswerte Unterkunft braucht. Und so macht er die Bekanntschaft von Sherlock Holmes, eines jungen Mannes, der gerade einen Mitbewohner für eine möblierte Wohnung sucht. Er wird beschrieben als ein Mann mit komischen Ideen, ein Enthusiast was einige akademische Disziplinen angeht, mit einer Leidenschaft für präzises, exaktes Wissen. Ganz gut in Anatomie und ein erstklassiger Chemiker, aber sehr sprunghaft und exzentrisch, was seine Studien angeht, hat er offensichtlich eine Menge abseitiger Kenntnisse angehäuft, über die seine Professoren staunen würden.
So begegnet Watson seinem künftigen Zimmergenossen und Begleiter bei vielen aufregenden Abenteuern, im Labor eines Krankenhauses, wo er soeben eine der praktischsten gerichtsmedizinischen Entdeckungen der letzten Jahre gemacht hat, die einen unfehlbaren Nachweis für Blutflecken liefert. Watson ist ebenso irritiert wie interessiert. Kurz gesagt, die beiden so unterschiedlichen jungen Männer sind sich sympathisch und schnell ist abgemacht: sie teilen sich zwei gemütliche Schlafzimmer und einen gemeinsamen großen Wohnraum bei Mrs. Hudson. Ihre neue Adresse, heute weltbekannt: 221b Baker Street.
Watson ist fasziniert von seinem neuen Bekannten, der ihn immer wieder verblüfft mit seinen rätselhaften Kenntnissen über Dinge, die er eigentlich gar nicht wissen kann und wohl nur durch irgendwelche heimlichen Schliche erworben hat. Dann aber entdeckt Watson einen Zeitungsartikel, in dem aufgezeigt wird, wie viel ein aufmerksamer Beobachter durch genaue und systematische Untersuchung all dessen, was ihm begegnet, zu lernen vermag. Wie alle anderen Künste, heißt es da, lässt sich die Wissenschaft der Deduktion und Analyse nur durch langes und geduldiges Studium erwerben. Watson hält das alles für unsägliches Geschwätz, aber Holmes widerspricht. Er selbst hat diesen Artikel geschrieben, und in der Folge wird er seinem neuen Zimmergenossen eine ganze Reihe Beispiele und Beweise für die Richtigkeit seiner Thesen liefern.
In einem Gespräch mit Watson erläutert er, wie wir uns seine Tätigkeit vorzustellen haben:
„Ich habe einen besonderen Beruf, ich glaube, ich bin der einzige Beratende Detektiv auf der Welt. Hier in London haben wir jede Menge beamtete Detektive und etliche private. Wenn diese Leute nicht weiterwissen, kommen sie zu mir, und ich bringe sie auf die richtige Fährte. (…) Das Beobachten ist mir zur zweiten Natur geworden.“
Sein neuester Fall scheint sich zu einem dieser komplizierteren zu entwickeln. Er beginnt mit einem kurzen Brief an Sherlock Holmes, in dem seine Hilfe erbeten wird. In einem leerstehenden Haus wurde der Leichnam eines gut gekleideten Gentleman gefunden, mit Karten in der Tasche, die ihn als Bürger der USA ausweisen. Es wurde nichts gestohlen, der Tote weist keinerlei Wunden auf, aber im Zimmer fanden sich Blutspuren. Wie der Mann hierher kam, ist unklar, überhaupt scheint dem Absender des Hilferufs die ganze Angelegenheit ein Rätsel. Holmes kennt ihn, es ist Gregson, den er für den intelligentesten Mann bei Scotland Yard hält.
„Er und Lestrade sind die Einäugigen unter den Blinden dort.“
Als Holmes und Watson am Tatort eintreffen, finden sie die beiden Detektive tatsächlich Ratlos vor. Ihre Untersuchungen haben sie keinen Schritt vorangebracht. Erst, als an einer Wand das mit Blut geschrieben Wort RACHE entdeckt wird und sich zudem der Ehering einer Frau findet, ist sich Lestrade sicher: „Wenn dieser Fall aufgeklärt ist, werden sie sehen, dass eine Frau namens Rachel etwas damit zu tun hatte.“
Natürlich ist Holmes schon viel weiter. Im Hinausgehen wirft er in den Raum: „Es ist ein Mord verübt worden, und der Mörder ist ein Mann. Er ist über sechs Fuß groß, im besten Alter, hat für seine Größe kleine Füße, trägt grobe Stiefel, die vorn viereckig enden, und er hat eine Trichinopoly-Zigarre geraucht. Er ist zusammen mit seinem Opfer in einem vierrädrigen Wagen hergekommen, der von einem Pferd mit drei alten Hufeisen und einem neuen am rechten Vorderhuf gezogen wurde. Höchstwahrscheinlich hat der Mörder ein blühendes Aussehen, und die Fingernägel seiner rechen Hand sind bemerkenswert lang. Das sind nur ein paar Hinweise, aber sie könnten ihnen nützlich sein.“ Lestrade und Gregson sehen einander mit einem ungläubigen Lächeln an. „Wenn dieser Mann ermordet worden ist, wie ist der Mord dann begangen worden?“ – „Gift“, und noch etwas, Lestrade. „Rache“ ist das deutsche Wort für „revenge“; vergeuden sie also nicht ihre Zeit damit, dass sie nach Miss Rachel suchen.“
So erhält Watson seinen ersten Anschauungsunterricht in den Methoden des Meisters, und er kann kaum glauben, dass Holmes sich völlig sicher ist. Als dieser ihm die Beobachtungen schildert, die zu seinen Schlussfolgerungen führten, ist Watson erst recht verwirrt. Ihm scheint alles nur noch mysteriöser, aber Holmes stellt fest, dass vieles zwar noch dunkel ist, sein Urteil über die wichtigsten Tatsachen aber bereits abgeschlossen. Wie später noch so oft macht sich Sherlock Holmes einen Spaß daraus, seine überraschten Gegenüber im Unklaren darüber zu lassen, wie er zu seinen erstaunlichen Erkenntnissen gekommen ist.
„Ich werde ihnen nicht viel mehr über diesen Fall erzählen, Doktor. Sie wissen schon: Ein Zauberer bekommt keinen Applaus mehr, wenn er erst seinen Trick verraten hat; und wenn ich ihnen zu viel von meiner Arbeitsmethode zeige, werden sie zu dem Schluss kommen, dass ich schließlich doch ein ganz gewöhnliches Individuum bin.“
„Zu diesem Schluss werde ich niemals kommen“,sagte ich. „Sie haben die Detektion einer exakten Wissenschaft so weit angenähert, dass man sie in dieser Welt nicht mehr übertreffen wird.“
Worauf Holmes, wie Watson weiter ausführt, errötet, weil er für Schmeicheleien über seine Kunst äußerst empfänglich ist. Natürlich weiß er, dass er nicht ganz gewöhnlich ist, er ist selbstbewusst genug, zu erkennen, dass er mit seinen besonderen Fähigkeiten den meisten Menschen weit überlegen ist, und es macht ihm große Freude, diese Überlegenheit zu demonstrieren und effektvoll zu inszenieren. So kann man kritisch anmerken, dass der bewunderte Detektiv (oder der Autor) durchaus Details verschweigt oder irreführende Hinweise gibt, um den Leser hinzuhalten und dann mit einer wohlgesetzten Schlusspointe die Lösung des Rätsels zu verraten. Der geniale Detektiv hatte natürlich längst alles durchschaut, während alle anderen die brillanten Folgerungen und fantastischen Gedankengängen des Meisters nicht nachvollziehen können.
Wer die Geschichten heute liest, ist kaum noch auf so plumpe Weise hinters Licht zu führen, für ihn liegt der Reiz möglicherweise im Geist des viktorianischen Zeitalters, der die Geschichten durchweht, und in der eleganten, angenehmen Sprache der Epoche, in der diese dargeboten werden. Für den zeitgenössischen Leser allerdings war vermutlich Sherlock Holmes‘ Kunst der Deduktion durchaus zum Staunen, weil noch recht unbekannt und wenig beschrieben. Genau genommen hatte Sherlock Holmes zwei Vorläufer, die sich ähnlicher Methoden bedienten, und Conan Doyle kannte sie sehr gut: Da erschien zunächst ein Chevalier Auguste Dupin im Jahre 1841 auf der Bühne der Weltliteratur. Edgar Allan Poe ließ seinen genialen Spürhund in den folgenden Jahren in drei Detektivgeschichten ermittel. Auch Dupin hatte einen Gefährten, der über die Fälle anschließend berichtet, und er hatte auch schon einige Marotten und bemerkenswerte Angewohnheiten, die seine Nachfolger auszeichnen sollten. Insbesondere hatte auch dieser grandiose Geist die Angewohnheit, seine Umgebung mit den erstaunlichen Ergebnissen seiner Deduktionen zu verblüffen.
Im Jahre 1863 erschien dann das erste Abenteuer des Monsieur Lecoq, eines jungen Polizisten und späteren Inspektors, den Emile Gaboriau erfunden hat. Auch dieser scharfsinnige Detektiv löst in einer Reihe erfolgreicher Romane sämtliche Rätsel durch logische Schlussfolgerungen. Conan Doyle war also keinesfalls der erste, der einen solchen Detektiv ins Rennen schickte, und Holmes nicht der erste, der sich mit seinen Ermittlungsmethoden einen Namen machte. Unterhalten sich Holmes und Watson im vorliegenden Roman über die beiden Vorgänger unseres Meisters. Watson bewundert sie und ist ein wenig indigniert, als Holmes sie schlichtweg als „minderen Gesellen“ und „ miserablen Stümper“ bezeichnet. Somit stellt Conan Doyle klar: Holmes ist mit Dupin oder Lecoq nicht zu vergleichen, und er selbst nicht einfach ein Nachfolger von Poe und Gaboriau.
Sein erster Detektivroman aber ist weder besonders noch besonders interessant oder spannend, im Gegenteil. Dem Leser wird einiges an Geduld abverlangt, denn der möglicherweise noch unsichere weil unerfahrene Schriftsteller Conan Doyle traut sich offenbar noch nicht, ganz auf seine beiden Helden und ihre gemeinsamen Abenteuer zu setzen. So kommt es, dass dieser erste Roman zweigeteilt ist, die „Erinnerungen von John H. Watson M.D.“ brechen im entscheidenden Moment ab und es folgt eine längere Schilderung von Ereignissen in Utah nach der Gründung von Salt Lake City durch die Mormonen. Diese Vorgeschichte zu den Morden im London des Jahres 1881 muss natürlich ohne Holmes und Watson auskommen und macht den Leser stattdessen bekannt mit John Ferrier und den Umständen, die ihn zu einem erbarmungslosen Rachefeldzug führten. Auch das ist durchaus schön und spannend geschrieben, aber eigentlich wartet man nur auf den „Fortgang der Erinnerungen von John Watson“, in denen das Geschehen um die „Studie in Scharlachrot“ vollständig aufgerollt wird.
John Ferrier fasst die Ereignisse von Beginn an bis zum überraschenden Ende zusammen und Holmes darf dozieren, wie und warum er das alles schon vor diesem Geständnis wissen konnte und also den Täter überführen und festnehmen konnte. Es endet wie in vielen Fällen, die Holmes in der Folge auf seine geniale Art lösen wird: Lestrade und Gregson heimsen die Lorbeeren ein, Holmes muss sich vorläufig mit dem Wissen um die Wahrheit bescheiden und mit der Aussicht auf die Veröffentlichungen seines Chronisten, der die Tatsachen irgendwann zurechtrücken wird.
*Alle Zitate entstammen der Taschenbuch-Ausgabe sämtlicher Sherlock-Holmes-Geschichten und -Romane des Insel Verlages, Eine Studie in Scharlachrot insel taschenbuch 3313.
Rezension und Foto von Kurt Schäfer.
Eine Studie in Scharlachrot | Erstveröffentlichung 1881
Die aktuelle gelesene Ausgabe erschien am 26. November 2007 bei Insel im Suhrkamp Verlag
ISBN 978-3-458-35013-2
189 Seiten | 7.- Euro
Bibliografische Angaben & Leseprobe
Diese Rezension erscheint im Rahmen unseres .17special Adventsspezials Privatdetektive.
Auch bei uns: Gunnars Rezension zu Die Abenteuer des Sherlock Holmes von Sir Arthur Conan Doyle