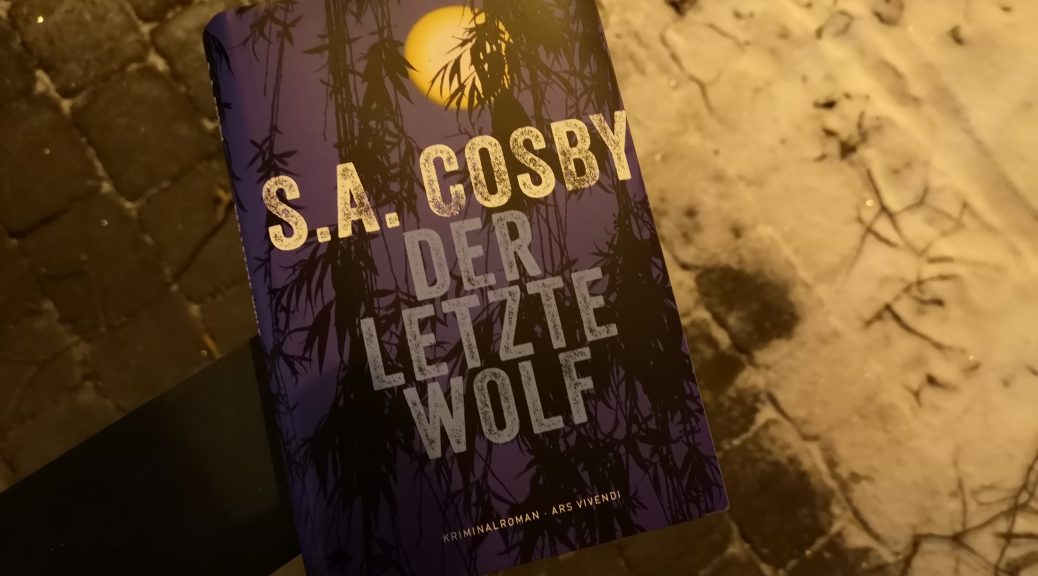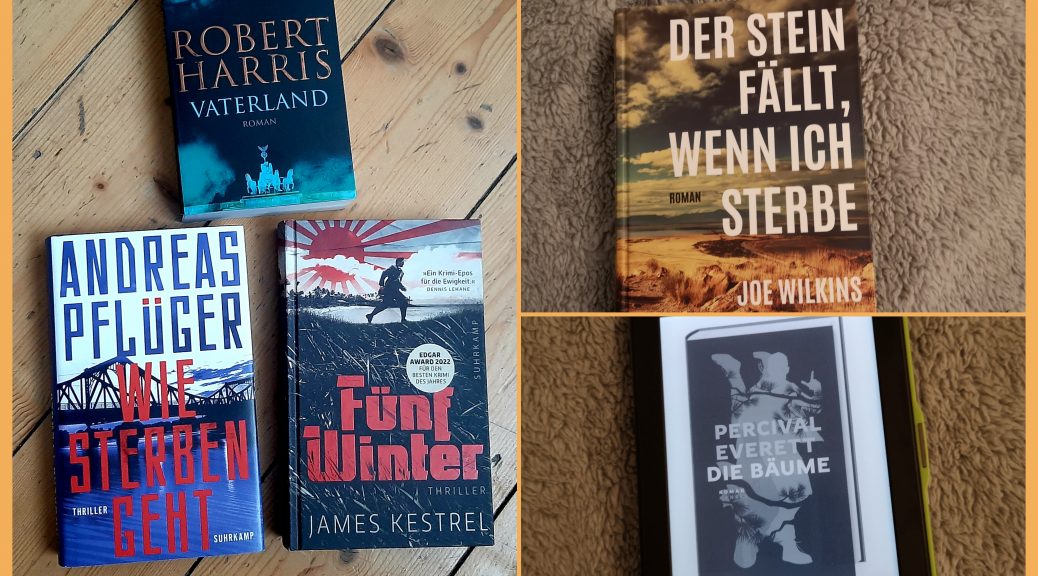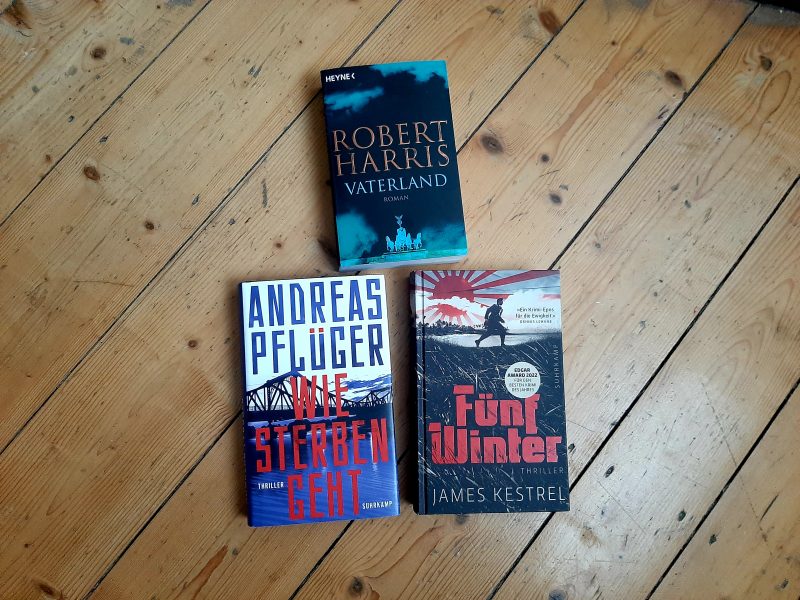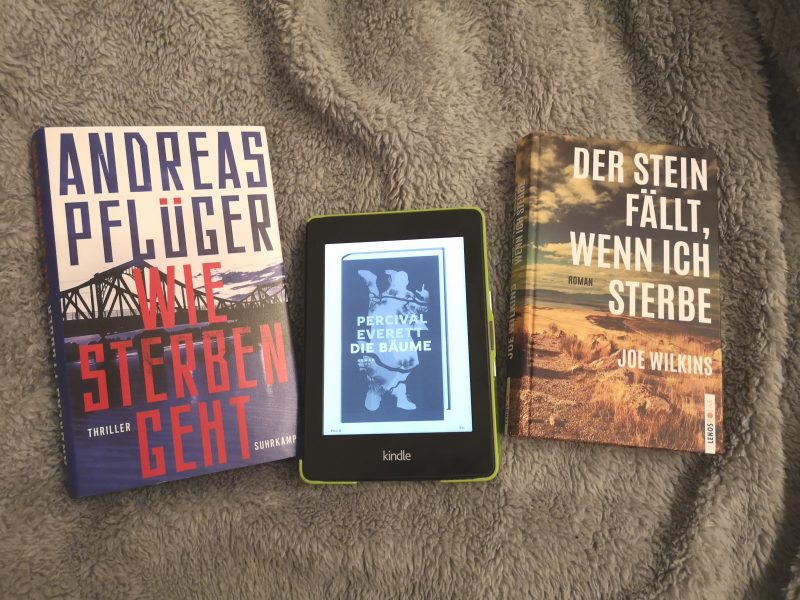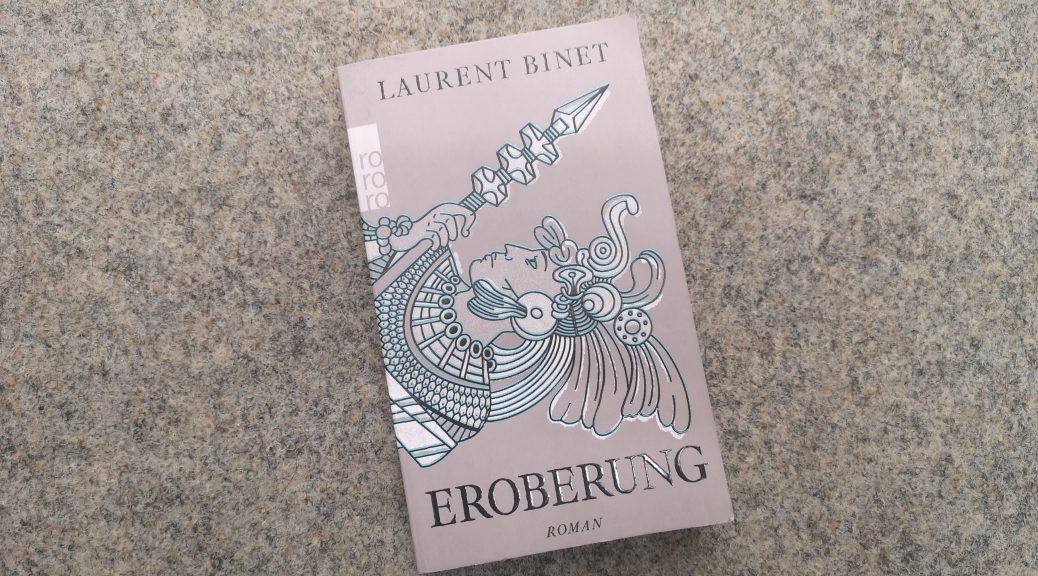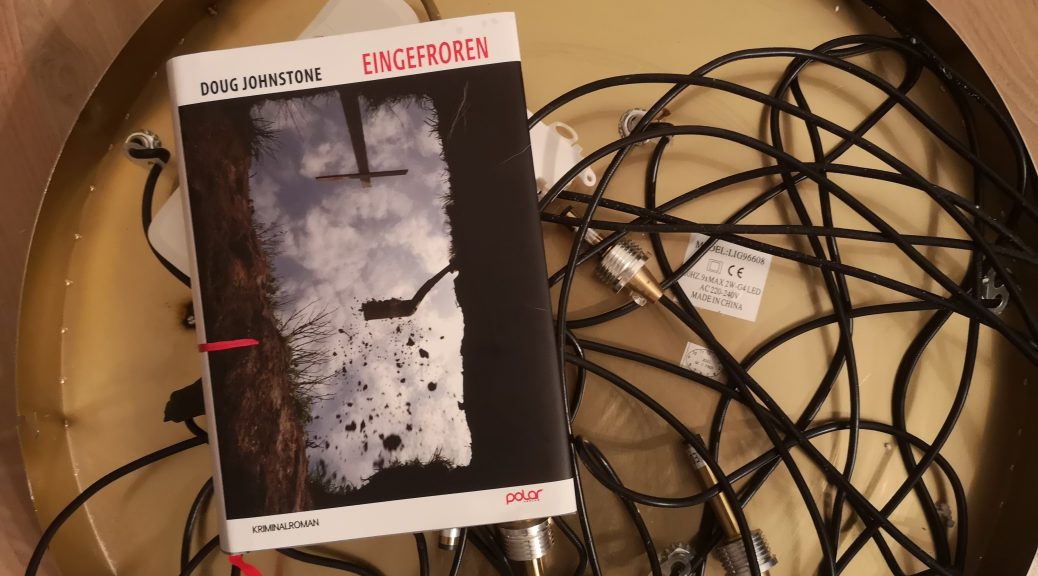
Doug Johnstone | Eingefroren (Band 2)
„Wenn man immer in dem Universum endet, in dem man überlebt, bedeutet das nicht, dass man alles tun kann, was man will?“
„Ich glaube, das bringt uns nicht weiter.“
„Vielleicht ist es das, was mein Dad dachte“, sagte Hannah. „Vielleicht glaubte er, er könnte einfach alles tun, worauf er Bock hätte, und käme damit durch.“
Rita seufzte. „Männer brauchen keine Quantenphysik, um zu meinen, sie kämen mit allem durch.“ (Auszug S.21)
Beim letzten Mal sind sie noch gerade davongekommen, die Skelfs. Dorothy, die Großmutter, Jenny, die Mutter und Hannah, die Enkelin. Bestattungsunternehmerinnen in Edinburgh und gleichzeitig – interessante Kombination – Inhaberinnen einer Detektei. Im ersten Band „Eingeäschert“ (Vorsicht: Spoiler) werden die drei Frauen von Craig, Jennys Ex und Hannahs Vater und ein Mörder und Psychopath, attackiert und teilweise schwer verletzt. Jetzt, ein halbes Jahr später ist zumindest oberflächlich etwas Ruhe eingekehrt, doch sie haben noch ganz schön dran zu knapsen. Doch die Ruhe ist nicht von langer Dauer, denn auch aus dem Gefängnis heraus, kann Craig das Seelenleben der Frauen attackieren.
Daneben belastet sich dieses Frauen-Trio aber auch noch mit anderen Dingen. Direkt der Beginn ist spektakulär, als während einer Bestattung sich ein Auto auf dem Friedhof mit der Polizei eine Verfolgungsjagd liefert, Dorothy beinahe überfährt und schließlich in ein offenes Grab stürzt. Der Fahrer, ein Autodieb, überlebt nicht, allerdings sein Hund auf der Rückbank. Dorothy nimmt sich des Tieres an und recherchiert nach dessen verstorbenen Herrchen, den niemand identifizieren kann und den scheinbar niemand vermisst. Gleichzeitig macht sie sich Sorgen um eine ihrer Schülerinnen beim Schlagzeug-Unterricht, die offenbar von zuhause ausgerissen ist. Hannah hingegen ist noch stark von den Ereignissen aus „Eingeäschert“ angegriffen und gerät erneut aus dem Tritt, als sich ein Professor an der Uni das Leben nimmt und sich keiner das so recht erklären kann. Somit will Hannah überdingt die Hintergründe aufklären.
„Ich muss es einfach verstehen.“
Edward gestikulierte über den leeren Hörsaal. „Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen.“
„Was das Universum betrifft. Aber was ist mit hier?“ Hannah klopfte auf ihre Brust. „Sicher müssen wir uns doch verstehen, oder nicht?“ (Auszug S.188)
Die verschiedenen Handlungsstränge werden parallel erzählt und immer wieder mischt sich Craig ein, der die Frauen in der Familie immer noch nicht in Ruhe lassen will. Dieser Strang bedient die vertikale Erzählweise in dieser Serie und dient immer wieder als Bindeglied zwischen den anderen kleinen Dramen, die die Skelfs umgeben. Doug Johnstone wechselt von Kapitel zu Kapitel die Perspektiven zu Dorothy, Jenny und Hannah und nimmt uns mit in ihr Seelenleben. Drei starke Frauen, vom Leben angeknockt, aber nicht gebrochen, sondern eine warme Menschlichkeit aussendend. Johnstone versteht es, seinen Figuren eine enorme Tiefe und Authentizität zu geben, auch den Nebenfiguren, wie etwa Hannahs Partnerin Indy, die sich bei den Skelfs zur Bestatterin ausbilden lässt, der Polizist Thomas, der zu der verwitweten Dorothy eine enge Beziehung aufzubauen scheint, oder Archie, Angestellter mit großem Talent, versehrte Leichen wieder zur Bestattung ansehnlich herzurichten und dabei unter dem Cotard-Syndrom leidend, d.h. dass er nicht an die eigene Existenz glaubt.
Auch Anspielungen auf die moderne Physik kommen hier nicht zu kurz, schließlich ist der Autor von normalem Beruf Atomphysiker. Der Originaltitel „The Big Chill“ verweist dann auch auf eine Theorie zum Ende des Universums. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, ob das hier überhaupt noch ein Krimi ist. Es ist auch ein Krimi, schon allein mit der Story um Craig, die hier in diesem Roman weiter eskaliert. Aber es ist vor allem auch ein starkes Buch über komplexe Familiensituationen, um den Umgang mit dem Tod und über drei starke Frauen. Und das lässt mich auf den nächsten Band mit den Skelfs freuen.
Foto und Rezension von Gunnar Wolters.
Eingefroren | Erschienen am 01.11.2023 im Polar Verlag
ISBN 978-3-948392-87-1
384 Seiten | 26,- €
Originaltitel: The Big Chill | Übersetzung aus dem Englischen von Jürgen Bürger
Bibliografische Angaben & Leseprobe
Weiterlesen: Gunnars Rezensionen zu Doug Johnstones „Eingeäschert“ und „Der Bruch“