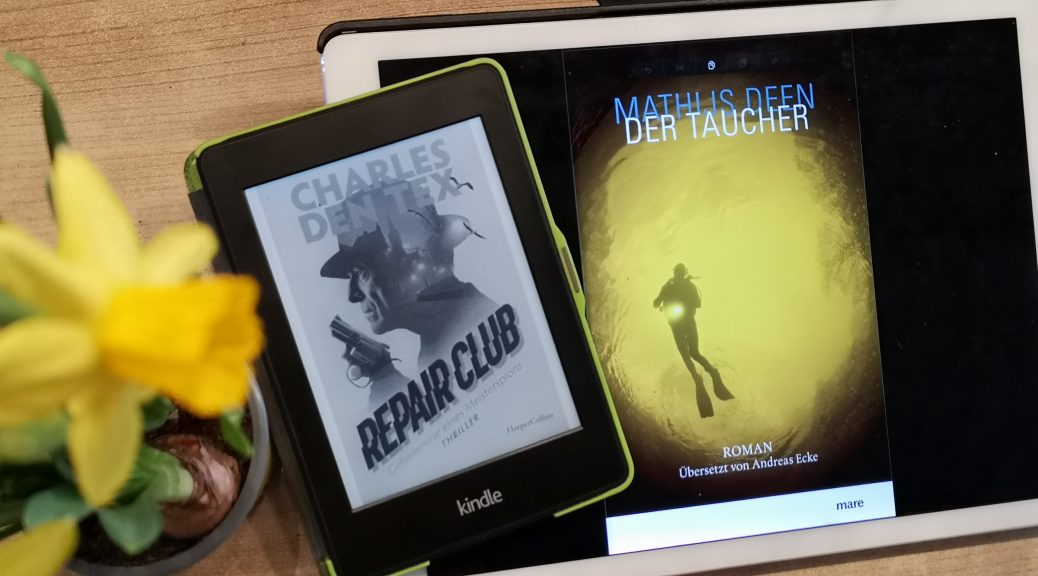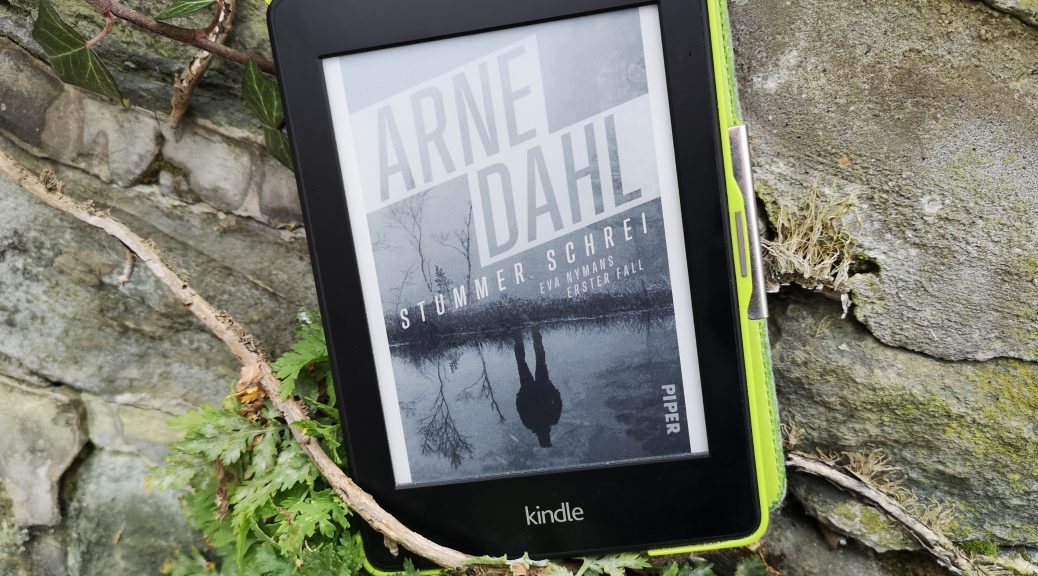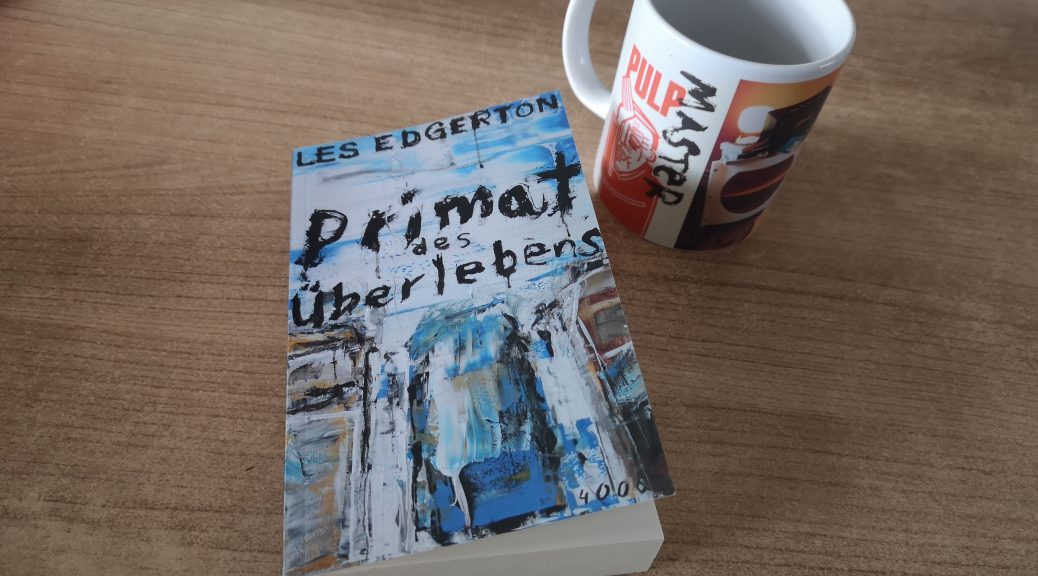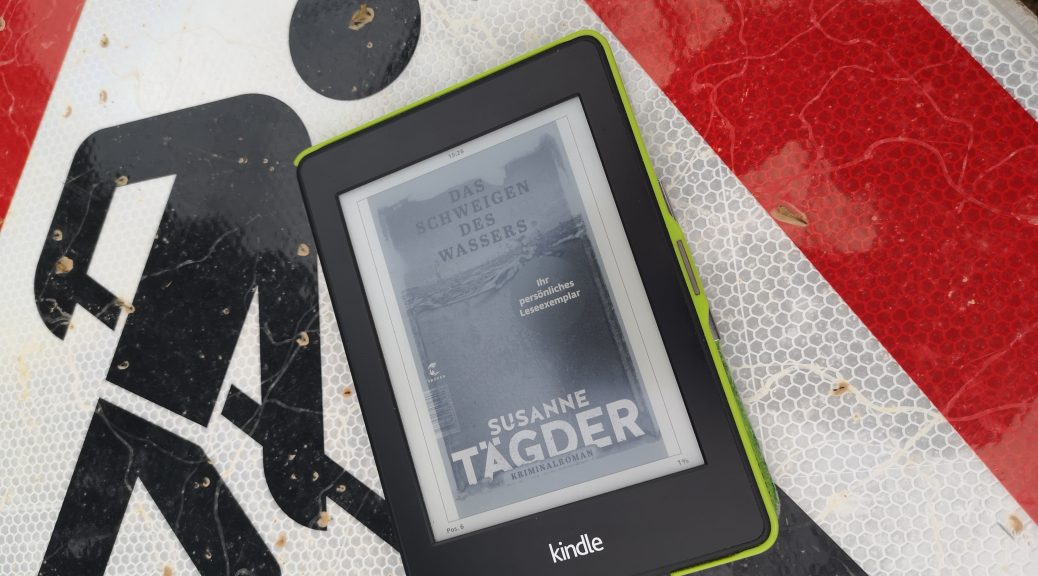
Susanne Tädger | Das Schweigen des Wassers
Die DDR ist jetzt bereits schon 30 Jahre Geschichte und dennoch auch heute noch irgendwie präsent in allerlei soziologisch-politischen Kontexten. Frei nach Faulkners „Das Vergangene ist nicht tot; es ist nicht einmal vergangen.“ Das gilt auch für die Kriminalliteratur, die selbstverständlich gerne Unaufgearbeitetes aus der Vergangenheit aufgreift, natürlich auch aus der deutsch-deutschen. Zuletzt hatte mir etwa „Die Toten von Marnow“ von Holger Karsten Schmidt gut gefallen, in dem es um Medikamentenversuche in der damaligen DDR ging. Nun greift die Autorin Susanne Tägder in ihrem Krimidebüt einen alten Kriminalfall auf, der zu DDR-Zeiten nicht aufgeklärt wurde (zumindest wurde ein Verdächtiger freigesprochen) und der nun in der Zeit kurz nach der Wiedervereinigung wieder hochkommt. Es ist die Zeit der Umbrüche, viele werden in neue Lebenssituationen geworfen. Und einige stellen fest, dass sie auch im neuen System abgehängt werden, während die Opportunisten den Absprung glatt geschafft haben und dafür sorgen, dass alte Ungereimtheiten weiterhin unter dem Teppich bleiben.
Groths Leben hat 1960 mit einer Fahrkarte begonnen. Oder aufgehört, je nachdem, wie man die Sache betrachtet. Mit einer Fahrkarte nach Hamburg. Aus ihm unerfindlichen Gründen erinnert er sich sogar noch an den Preis: acht mark siebzig. Im Schaukasten, das Groths Leben ausstellt, wäre diese Fahrkarte ein zentrales Artefakt. (Auszug E-Book Pos.1640)
Herbst 1991 in Mecklenburg: Der Hamburger Kommissar Arno Groth ist als Aufbauhelfer Ost in seine alte Heimat Wächtershagen (steht wohl für Neubrandenburg) versetzt worden. Damals war er als junger Abiturient mangels Perspektive vor dem Mauerbau in den Westen gegangen. Nun kehrt er zurück, gibt Seminare für die Ost-Kollegen über nunmehr gesamtdeutsche Polizeiarbeit, aber es ist nicht ganz klar, wer hier wen aufbaut. In Hamburg ist der geschiedene Groth, der immer noch um seine verstorbene Tochter trauert, beruflich aufs Abstellgleis geraten, nachdem er einen Fall vermasselt hat, weil er zu stark einer Zeugin vertraut hatte. Groth bekommt schon nach kurzer Zeit Besuch auf der Dienststelle von einem merkwürdigen, heruntergekommenen Mann, der ihn vom Hof aus beobachtet. Dieser Mann heißt Siegmar Eck, ist Verleiher von Tretbooten und aktuell ohne festen Wohnsitz. Er fasst nach einem kurzen Gespräch offenbar Vertrauen zu Groth und verspricht, nach dem Wochenende wegen eines Diebstahls wiederzukommen. Doch dazu wird es nicht kommen.
Zwei Tage später wird Eck tot am See aufgefunden, ertrunken, die Umstände sind unklar. Der Dienststellenleiter will den Fall zügig als Unfall einstellen. Doch ausgerechnet ein Kollege, mit dem Groth bislang alles andere als warm wurde, offenbart ihm, dass Eck kein Unbekannter war: Vor etwa zehn Jahren war er Hauptverdächtiger in einem Mord an einer jungen Frau, wurde aber vor Gericht wegen Ermittlungsfehler überraschend freigesprochen. Und obwohl die damaligen Akten zum großen Teil verschwunden sind, hat Groth einen Anhaltspunkt für weitere Ermittlungen.
Außer aus Groths wird die Geschichte noch aus einer weiteren Perspektive erzählt. Regine Schadow ist Servicekraft in der Ausflugsgaststätte am See, kannte Eck, rauchte öfter mal mit ihm eine Zigarette in der Pause. Regine war Angestellte in einer Bar in Berlin und ist nun nach Wächtershagen zurückgekehrt, angeblich um die Wohnung ihrer Großmutter aufzulösen. Der Leser wird schnell darauf gestoßen, dass sie etwas von Eck wollte. Und dies hängt auch mit dem damaligen Fall, dem Mord an Jutta Timm zusammen, denn Jutta war Regines große Schwester.
Als sie ihm sagte, wer ihre Schwester ermordet hat, zuckte Ludi nicht mal mit der Wimper. Fragte nicht: „Bist du sicher?“ Oder: „Wieso glaubst du das?“
Alles, was Ludi dazu anmerkte, war: „Oha.“ Und dass sie gut auf sich aufpassen müsse. „Wer es so weit nach oben geschafft hat, der räumt nicht so mir nichts dir nichts den Sessel. Wenn du verstehst, was ich meine.“ (Auszug E-Book Pos. 4051).
Susanne Tädger war Richterin in Karlsruhe, lebt inzwischen im Ausland und hat dennoch eine Verbindung in die DDR, denn ihre Eltern stammten von dort. Eine Reportage über einen ungelösten DDR-Mordfall aus der Süddeutschen Zeitung war Auslöser dieses Romans. Die Autorin versteht sich dabei als Meisterin der leisen Töne. Sie dringt tief in die Biografien der zentralen Figuren vor, die alle Traumata erlitten haben. Bei Groth und Regine Schadow über die Erzählperspektive, bei Eck indirekt über diejenigen, die über ihn berichten. Damit erzählt der Roman oft weniger von einem Mordfall, sondern von Brüchen, Umwälzungen, Schicksalsschlägen im Leben der Figuren. Das Ganze wirkt organisch, authentisch und verweist auf andere Literatur. Groth wird als „Literat“ von den Kollegen verspottet, der „Hungerkünstler“ von Kafka spielt eine Rolle, zudem liest er in Texten von Eck, der eine Art Liedermacher war. Insgesamt dringen Groth und Regine von unterschiedlichen Seiten langsam zur Lösung der Geschichte vor, die, man ahnt es bereits, keine vollständige Erlösung bieten kann. „Das Schweigen des Wasser“ ist ein wirklich guter, sehr stimmiger, unaufgeregter und melancholischer Kriminalroman, der viele Leser verdient hat. Der Blurb auf dem Klappentext vom von uns auch sehr geschätzten Andreas Pflüger kommt nicht von ungefähr.
Foto und Rezension von Gunnar Wolters.
Das Schweigen des Wassers | Erschienen am 16.03.2024 im Tropen Verlag
ISBN 978-3-608-50194-0
336 Seiten | 17,- €
Als E-Book: EAN 978-3-608-12254-1 | 13,99 €
Bibliografische Angaben & Leseprobe