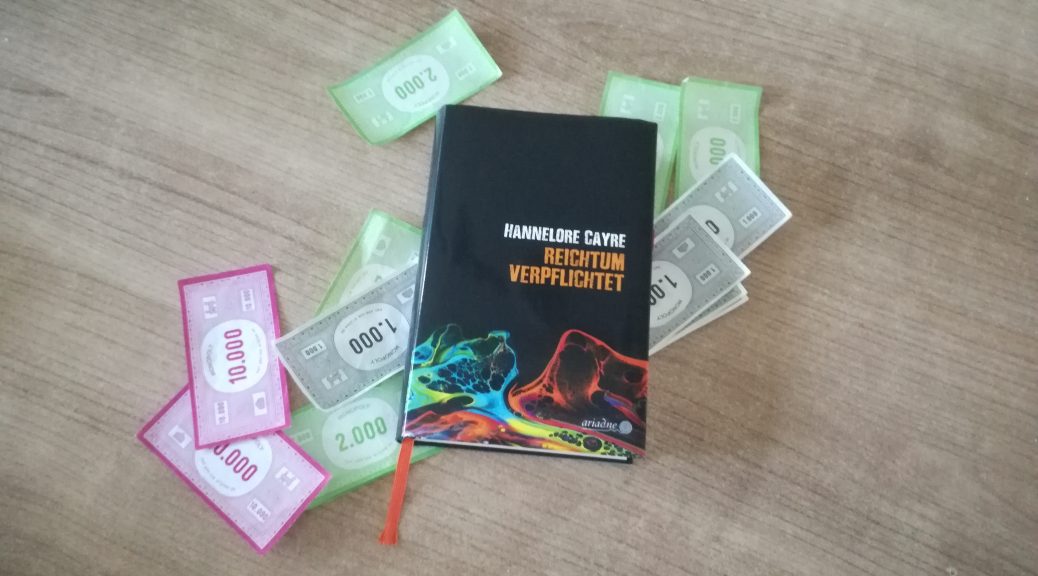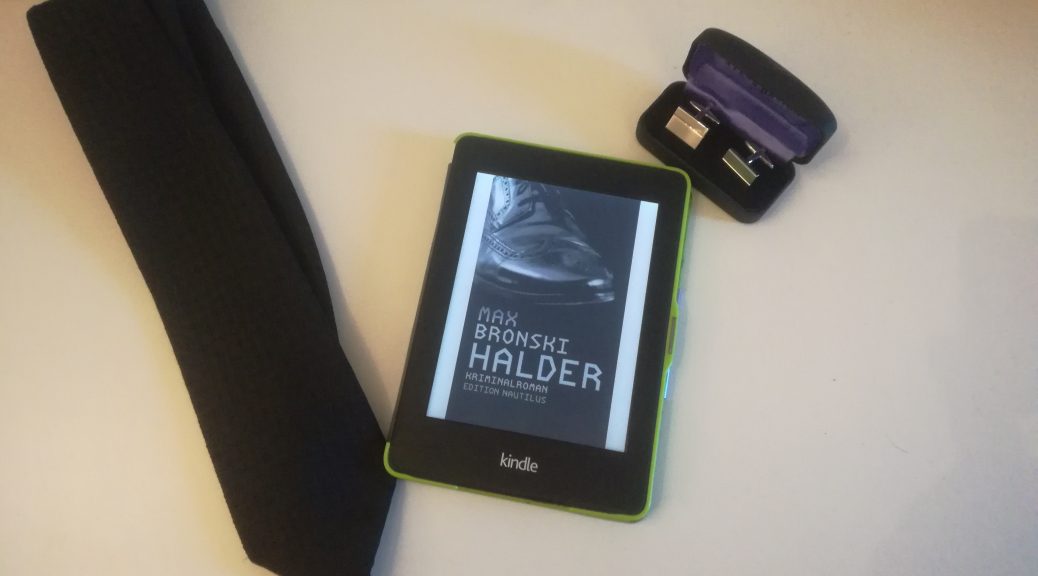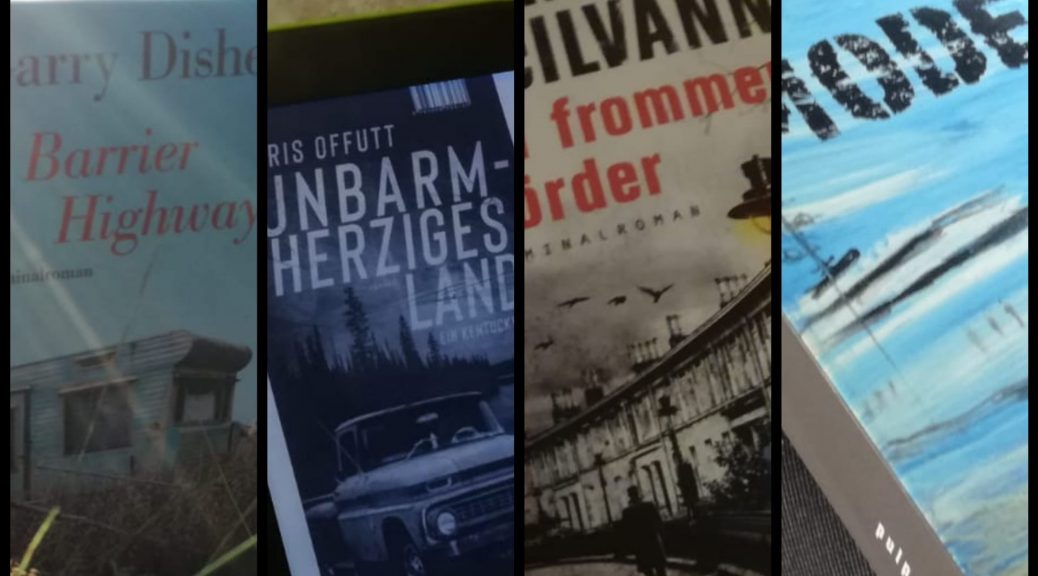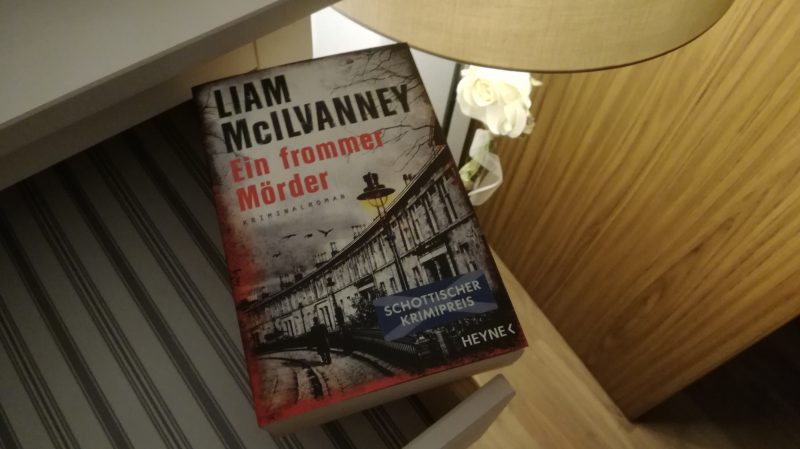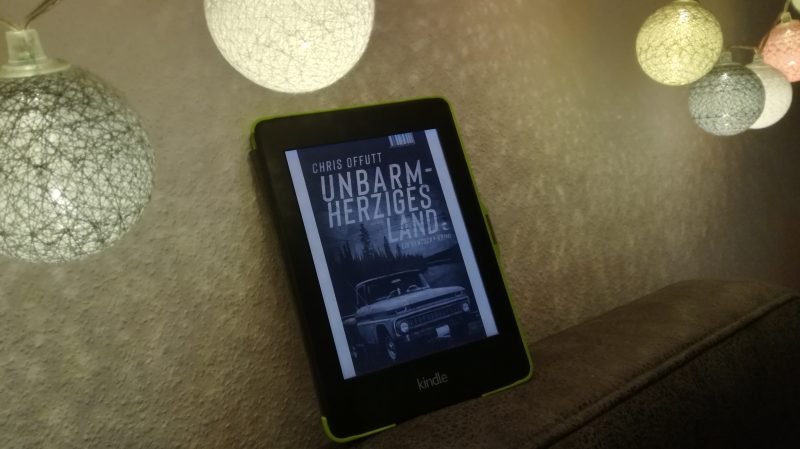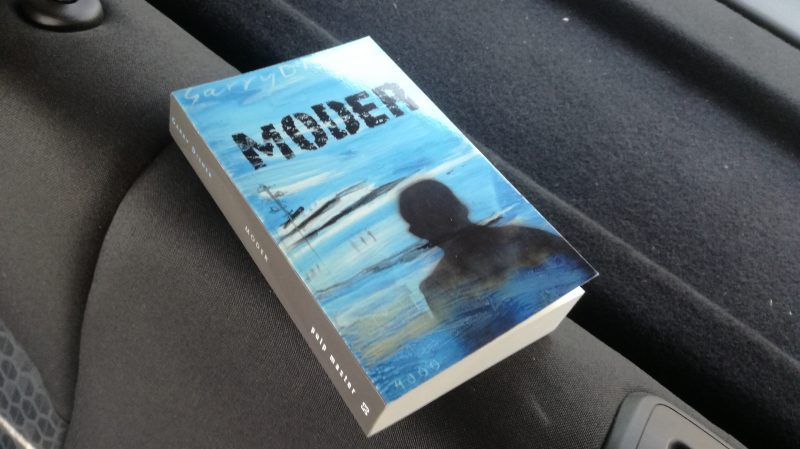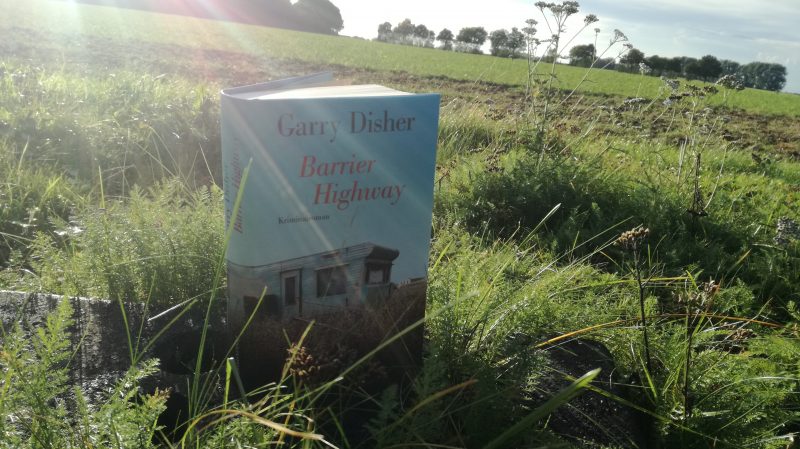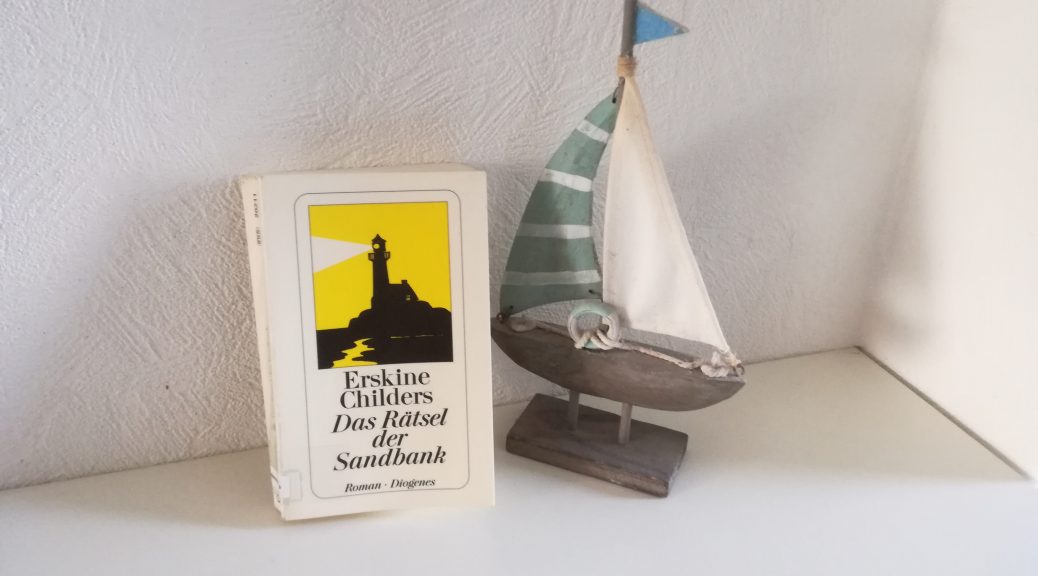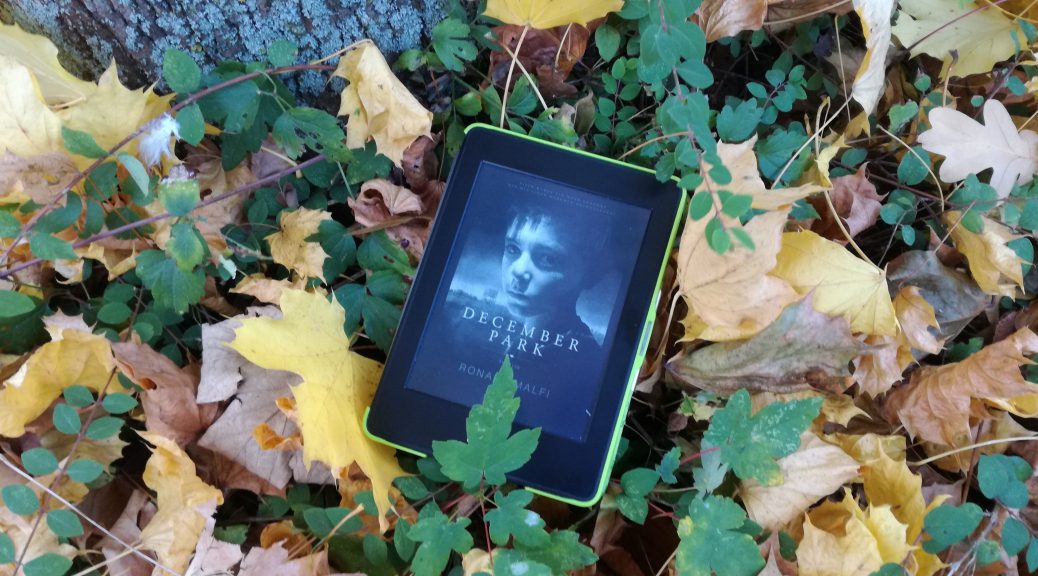
Ronald Malfi | December Park
Es war lang und weiß. Es war ein Tuch. Es war ein Tuch, das etwas bedeckte. Mir wurde flau im Magen. Ich hatte genug ferngesehen, um zu erkennen, was ich da vor Augen hatte. (Auszug E-Book, Position 155).
Im Herbst 1993 verschwinden mehrere Kinder in der beschaulichen Kleinstadt Harting Farms in Maryland, eine Küstenstadt an der Chesepeake Bay. Offiziell sind die Kinder nur vermisst, die Polizei hält es für denkbar, dass sie einfach nur von zuhause ausgerissen sind. Hinter vergehaltener Hand raunen die Menschen aber dennoch vom „Piper“, dem Rattenfänger, der die Kinder entführt.
Angelo Mazzone und seine Freunde Peter, Scott und Michael sind typische 15-16jährige Jungs, die heimlich rauchen, nach der Schule mit ihren Rädern die Gegend unsicher machen, gerne Schabernack treiben und versuchen, die Schule halbwegs zu überstehen (nur mit den Mädels haben sie es noch nicht so). Zufällig sind die Jungen mit ihren Rädern eines Oktobernachmittags in der Nähe des Waldrands am December Park und werden Zeuge eines großen Polizeiaufgebots. Die Polizisten bergen einen Körper aus dem Wald und als der Wind das Tuch verweht, stellen die entsetzten Jungen fest, dass es die Leiche eines vor kurzem verschwundenen Mädchens ist. Damit ist klar, die Kinder sind nicht einfach weggelaufen, sondern wurden ermordet. Weitere Leichen tauchen aber vorerst nicht auf.
Dafür erhält Angelo neue Nachbarn, eine seltsame Frau mit ihrem Sohn Adrian, in Angelos Alter. Adrian ist in sich gekehrt und eigenbrötlerisch, dennoch freunden sich Angelo und er an und Adrian wird nach und nach Teil von Angelos Clique. Adrian entwickelt eine große Faszination für die Fälle der verschwundenen Kinder, spätestens als er feststellt, dass das von ihm zufällig in der Nähe des Fundorts gefundene Medaillon dem toten Mädchen gehörte. Er steckt die anderen mit seinem Eifer an und bald geben sich die Jungen das Versprechen, dass sie den Piper aufspüren werden. Derweil verschwinden weitere Kinder und die Polizei tappt immer noch im Dunkeln. Tatsächlich finden die Jungen kleinere Spuren und Indizien, behalten dies aber für sich, selbst Angelos spricht nicht mit seinem Vater, immerhin einer der ermittelnden Detectives. Doch aus dem Detektivspiel wird irgendwann bitterer Ernst.
Ich steckte meinen Daumennagel zwischen die beiden Hälften und ds herzförmige Medaillon öffnete sich. Meine Großmutter besaß ei ähnliches Medaillon mit einem winzigen Foto von mir in der einen Seite und eines von Charles in der anderen – doch dieses hier war leer […]
„Okay“, entgegnete ich und verstand nicht recht, weshalb das alles für ihn so eine große Sache war.
„Es gehört ihr“, sprach er.
„Wem?“
„Dem toten Mädchen“, antwortete Adrian. „Courtney Cole“. (Auszug E-Book, Position 2904)
Autor Ronald Malfi lebt mit seiner Familie selbst an der Chesepeake Bay und ist vor allem auch durch seine Romane im Horror- und Mysterygenre bekannt. Auf Übernatürliches verzichtet er in dieser Geschichte allerdings, zum Schaudern gibt es allerdings durchaus etwas an einigen Passagen. Nach eigenen Angaben sind in diesen Roman auch Kindheitserinnerungen des Autors eingeflossen, vermutlich in der Figur des Ich-Erzählers Angelo Mazzone. Angelo ist ein durchaus cleverer Junge mit den üblichen Flausen im Kopf, er liebt es zu schreiben, will später einmal Schriftsteller werden. Er lebt mit seinem Vater und seinen Großeltern zusammen, seine Mutter ist früh verstorben. Als schwerer Schatten liegt der Tod seines Bruders Charles im Golfkrieg auf der Familie, insbesondere auf dem Verhältnis zwischen Angelo und seinem Vater. Auch auf seinem neuen Freund Adrian lastet eine schwere Vergangenheit: Seine Mutter und er sind überstürzt aus Chicago verzogen, nachdem Adrians Vater sich mit Autoabgasen umbrachte und Adrian mit in den Tod nehmen wollte.
„December Park“ steht natürlich in der Tradition anderer schauriger Coming-of-Age-Geschichten, auf dem obersten Sockel steht hier sicherlich Stephen King. Und tatsächlich erinnert man sich zwangsmäßig an „Es“ oder „Die Leiche“. Malfi macht seine Sache in Bezug auf Angelo, seine Clique, ihre Freundschaft, ihre Ängste und Konflikte auch nicht schlecht – die Tiefe von Kings Figuren erreicht er freilich nicht. Was schade ist, ist der Roman doch lang genug. Aber leider, muss man sagen, auch etwas zu lang, denn die Spannungsmomente lassen zwischendurch doch sehr auf sich warten. Überhaupt gibt es in der Genrewertung für einen Thriller da doch einige Abzüge. Neben der eher langsam erzählten Story (Die Jungs fahren verdammt viel Fahrrad im Buch) gab es für mich auch einige Unplausibilitäten, auch die Aufklärung am Ende fand ich wenig überzeugend. So muss ich letztendlich konstatieren: Solide bis ordentlich als Coming-of-Age, eher unterdurchschnittlich als Thriller.
Foto & Rezension von Gunnar Wolters.
December Park | Erschienen am 28.02.2018 im Luzifer Verlag
ISBN 978-3-95835-317-6
616 Seiten | 14,95 €
als E-Book: ISBN 987-3-95835-033-5 | 7,99 €
Originaltitel: December Park (Übersetzung aus dem Englischen von Ilona Stangl)
Bibliografische Angaben & Leseprobe