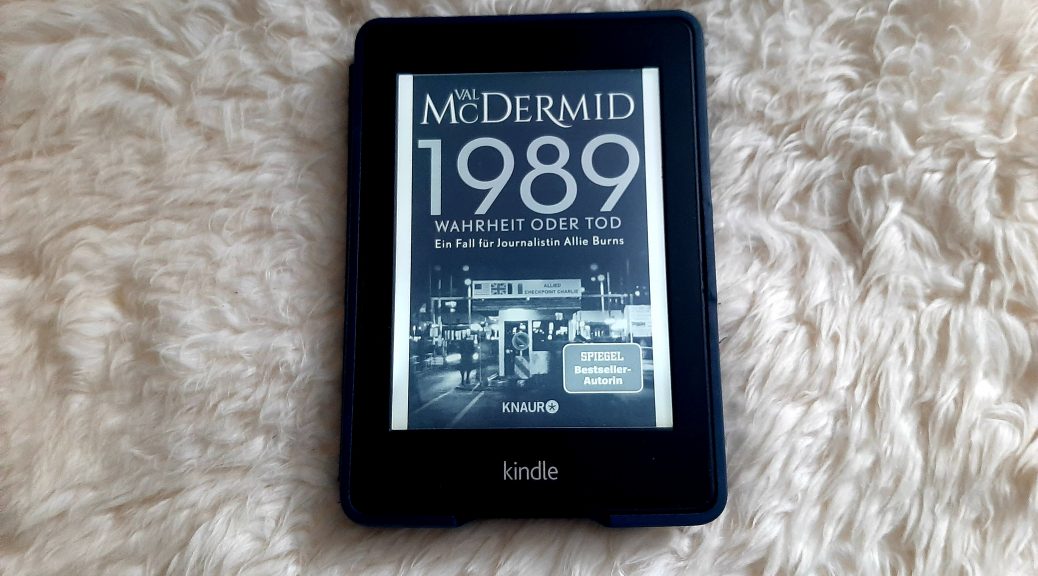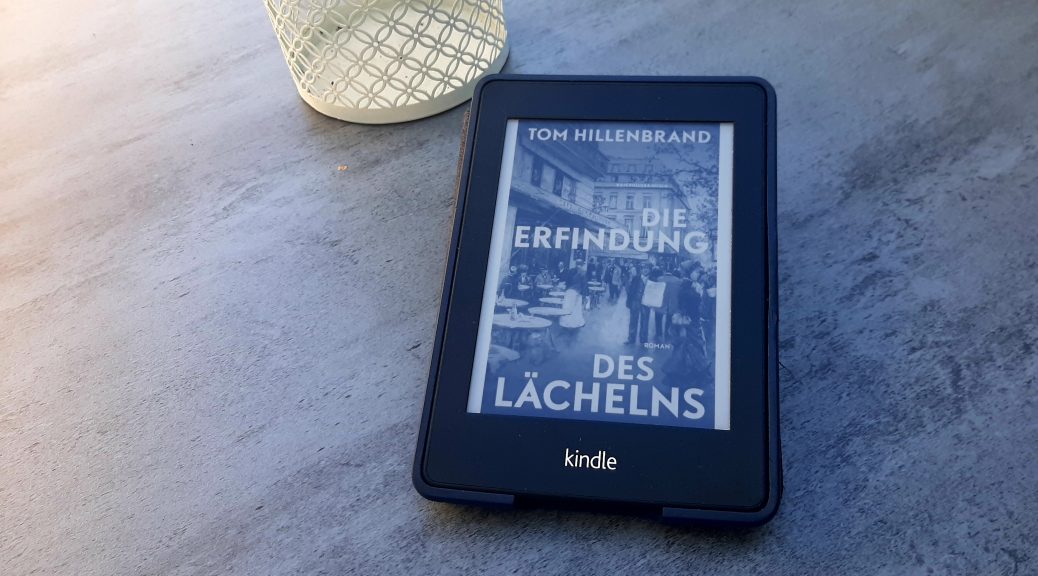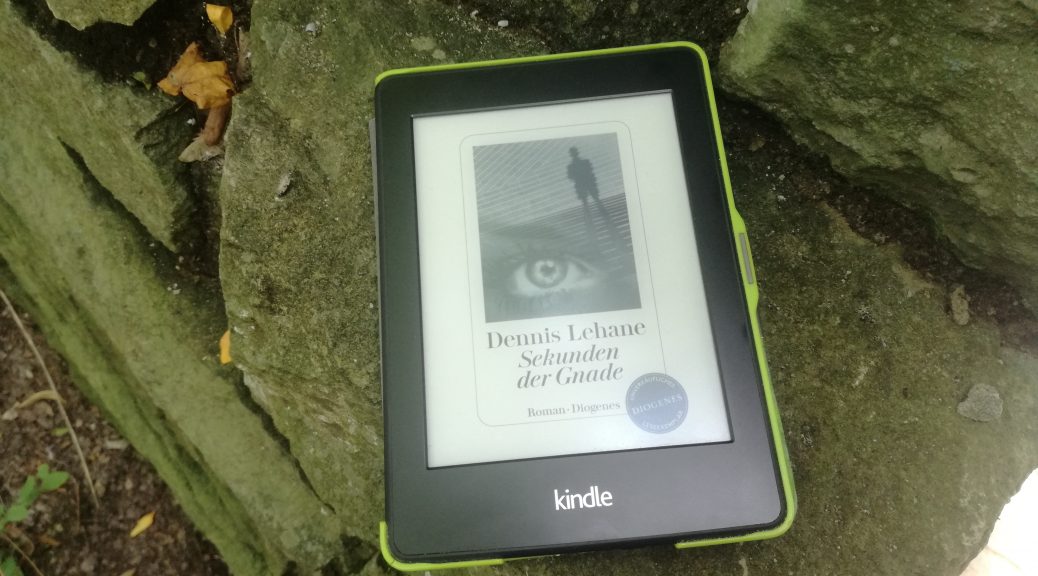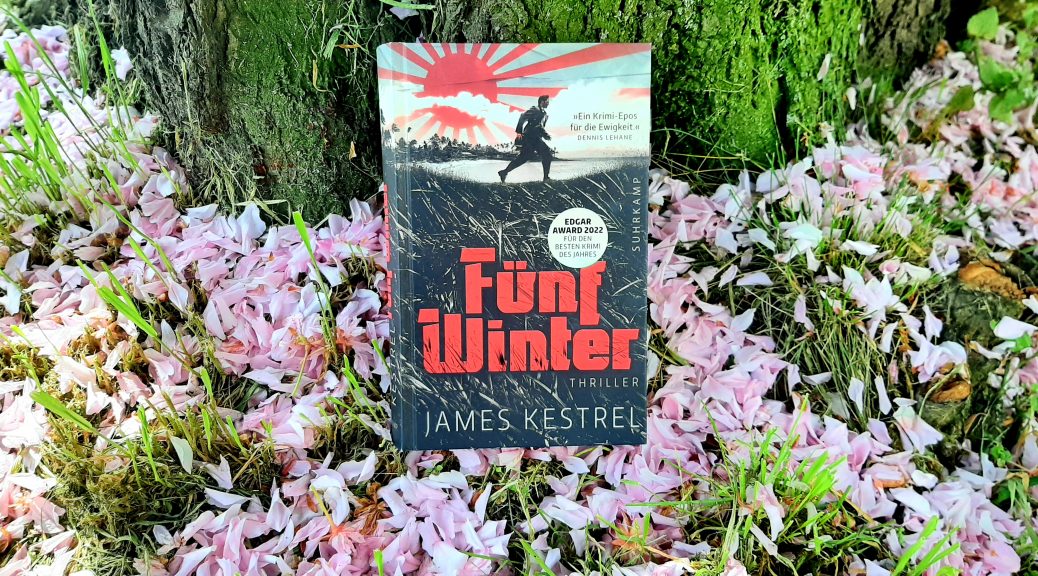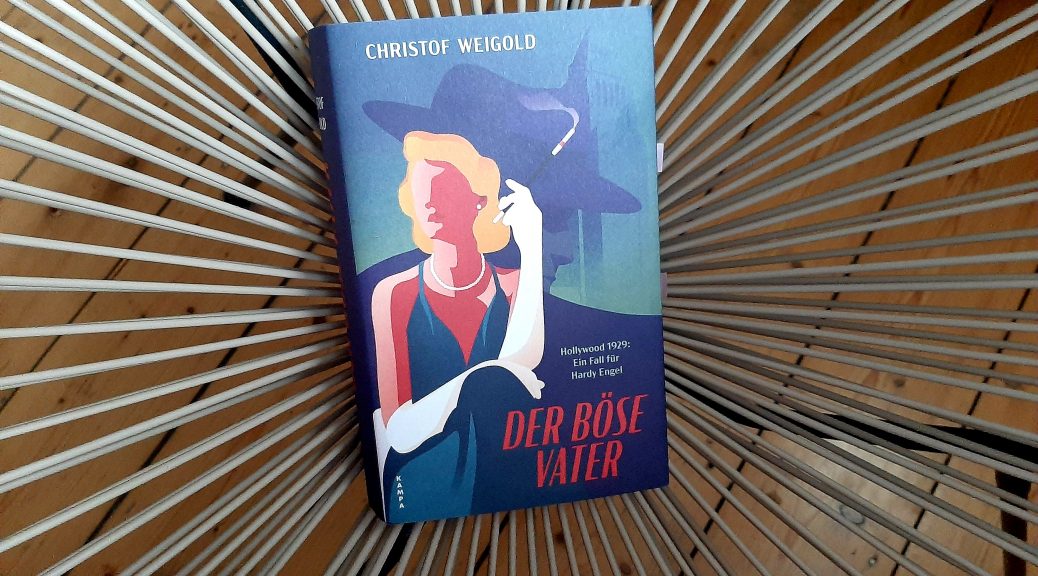
Christof Weigold | Der böse Vater (Band 4)
Nach langer Wartezeit und einem Wechsel zum Kampa-Verlag erschien endlich der vierte Band um den deutschstämmigen Privatdetektiv Hardy Engel in Los Angeles. Wir befinden uns im Jahr 1929 und unser Held sitzt seit mehreren Jahren unschuldig im Gefängnis. Völlig unerwartet kommt er auf Bewährung frei. Dafür sorgt der allmächtige Filmmogul und Verleger William R. Hearst unter dubiosen Umständen. Seine Freilassung ist an die Bedingung geknüpft, herauszufinden, wer den Tycoon erpresst.
Tod auf der Luxusyacht
Dabei geht es um einen mysteriösen Todesfall, der sich vor fünf Jahren auf Hearsts Luxusyacht Oneida ereignete. Der berühmte Filmpionier und Erfinder des Westerns Thomas Ince erkrankte während seiner Geburtstagsfeier schwer und verstarb kurz darauf vermeintlich an Herzversagen. Es geht um Schüsse, die angeblich gehört wurden und seitdem verstummen in Hollywood die Gerüchte nicht, Hearst sei nicht ganz unschuldig am Tod von Ince. Der unbekannte Erpresser soll im Besitz belastenden Materials sein, dass er dem Staatsanwalt zu übergeben droht. Hardy kann niemandem trauen, alle damals an Bord Anwesenden scheinen etwas zu verbergen, auch sein Auftraggeber verrät nicht die volle Wahrheit. Aber Hardy bleibt seinem Ruf treu, er will ohne Rücksicht die Wahrheit herausfinden und gerät bald zwischen die Machenschaften der großen Filmschaffenden.
„Wir müssen dringend sparen und ein Stummfilm wäre so dermaßen viel billiger!“ gab Uncle Carl zu bedenken. „Man sieht die Männer ja auch so fallen, ist das nicht ohne Ton viel unheimlicher?“ assistierte Bergerman. „Nein“, sagte ich und wechselte einen Blick mit Junior. „Die Schüsse, das Pfeifen und die Schreie, das ist der Krieg! Glauben Sie einem Veteranen!“ (Auszug Seite 429)
Einer davon ist der schwäbisch-stämmige Filmmogul Carl Laemmle, der seinem Sohn Julius „Junior“ Laemmle zum 21. Geburtstag die Universal Filmstudios übergibt. Junior will den Bestseller von Erich Maria Remarque „Im Westen nichts Neues“ gegen den Willen seines Vaters Carl Laemmle als Tonfilm herausbringen. Er überredet Kriegsveteran Hardy für dieses Projekt als Berater zur Verfügung zu stehen. Für Hardy, der immer noch unter seinen Kriegserlebnissen des 1. Weltkrieges leidet, kein einfaches Unterfangen. Und wäre das nicht genug Sorge, sucht er immer noch nach seiner Freundin Polly Brandeis, die schwanger nach einigen Besuchen im Knast spurlos verschwand.
Vom Stummfilm zum Tonfilm
Wie schon in den drei vergangenen Bänden der historischen Krimireihe schildert Christof Weigold das vielfältige Leben in Hollywoods goldenem Zeitalter. Die Traumfabrik hat sich in den fünf Jahren, die Engel einsaß, schon wieder stark verändert, es gibt viel mehr Stars, bereits Touristen und einen höheren Glamourfaktor. Weigold hat erneut hervorragend recherchiert, geschickt reale Fakten mit Fiktion verknüpft und fängt das Flair dieser Zeit wirklich gut ein. Die Filmindustrie befindet sich auf der Schwelle vom Stummfilm zum Tonfilm. Der Wandel bringt neue Stars hervor, bedeutet für manchen Stummfilmstar aber auch das Ende der Karriere. Unter anderem befürchtete die Schauspielerin Marion Davies, jahrelange Geliebte Hearsts aufgrund ihres Stotterns auf dem Abstellgleis zu landen.
Die Zeit um 1929 ist eine höchst instabile, die Prohibition ist noch aktuell, der Börsencrash steht unmittelbar bevor. Filmstudios stehen am Rand der Pleite, werden aufgekauft. Es geht um Macht, feindliche Übernahmen und das ganz große Geld, wobei Hearst einer der wirklich großen Player ist. Wir begegnen bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern mit komplizierten Liebesleben. Es gibt ungewollte Schwangerschaften, heimliche Kinder, falsche Mütter und böse Väter. Wir begleiten Harry nicht nur zum Dreh von „Im Westen nichts Neues“, sind auch auf den aufregendsten Partys dieser Zeit dabei, wo er Größen wie der nackten Greta Garbo begegnet, treffen Charlie Chaplin im ältesten Restaurant Hollywoods „Musso & Frank‘s“ oder verfolgen die Intrigen der ersten Oscar-Verleihung, bevor es dann noch mal spannend auf einem Casinoschiff wird, auf dem sich die vergnügungs- uns spielsüchtigen Amerikaner treffen.
Meine Meinung
Ich bin wieder so gerne in diese alte Hollywood-Welt eingetaucht. Ich mag einfach den lässigen, humorvollen aber auch ausschweifenden Erzählstil Weigolds. Es ist amüsant, wenn Harry auf einer Kostümparty auf dem Hearst-Anwesen einem hübschen Jungen namens Jack Kennedy begegnet, der sich als US-Präsident Teddy Roosevelt verkleidet. Dramatisch wird es, wenn Engel mit der jüdischen Laemmle-Familie im Zeppelin in die alte Heimat fliegt und in Wilhelmshafen auf jubelnde Nazis stößt. Interessant, wenn sie in Berlin versuchen, den charismatischen Remarque zu überreden, die Hauptrolle zu übernehmen.
Ein großer Lesespaß auf über 600 Seiten besonders für Filmfans, mit einigen gewagten Handlungssprüngen. Ich bin gespannt auf den nächsten Band, es gibt ja noch einige unaufgeklärte sowie legendäre Skandalfälle.
Funfact: Orson Welles portraitierte 1941 in seinem legendären, von vielen Filmkritikern als bester Film aller Zeiten gewählten Klassiker „Citizen Kane“ die Beziehung zwischen William Randolph Hearst, dem Erfinder der Boulevard-Presse und seiner Geliebten Marion Davies.
Foto und Rezension von Andy Ruhr.
Der böse Vater | Erschienen am 28. August 2023 im Kampa Verlag
ISBN 978-3-311-12068-1
624 Seiten | 28.- Euro
Bibliografische Angaben & Leseprobe
Weiterlesen: Andys Rezensionen zur Hardy Engel-Reihe von Christof Weigold