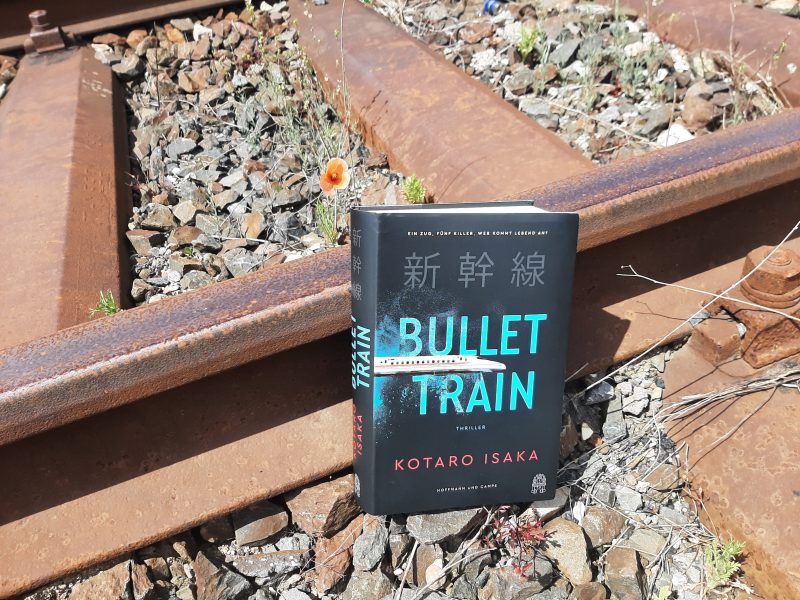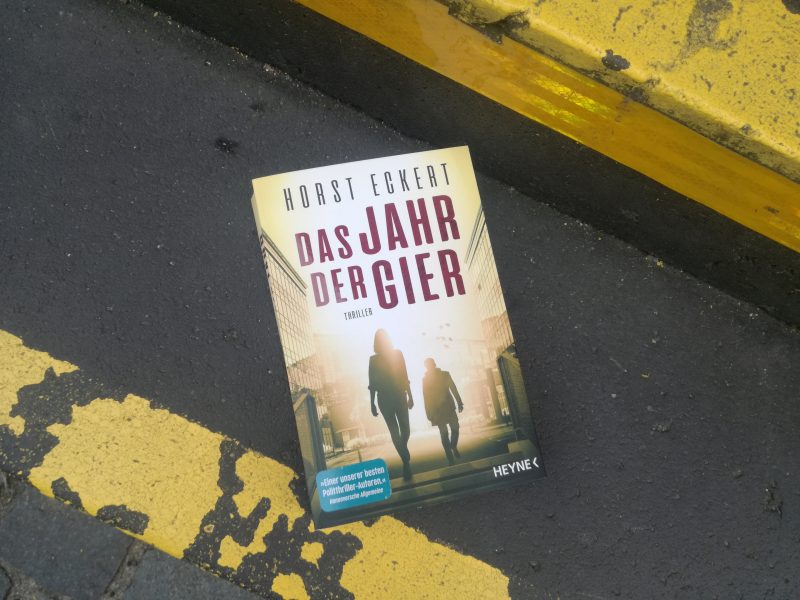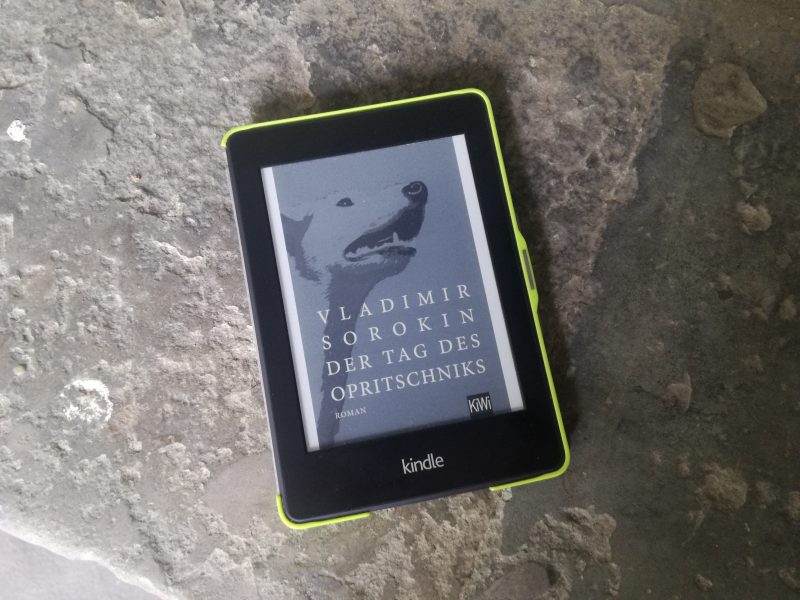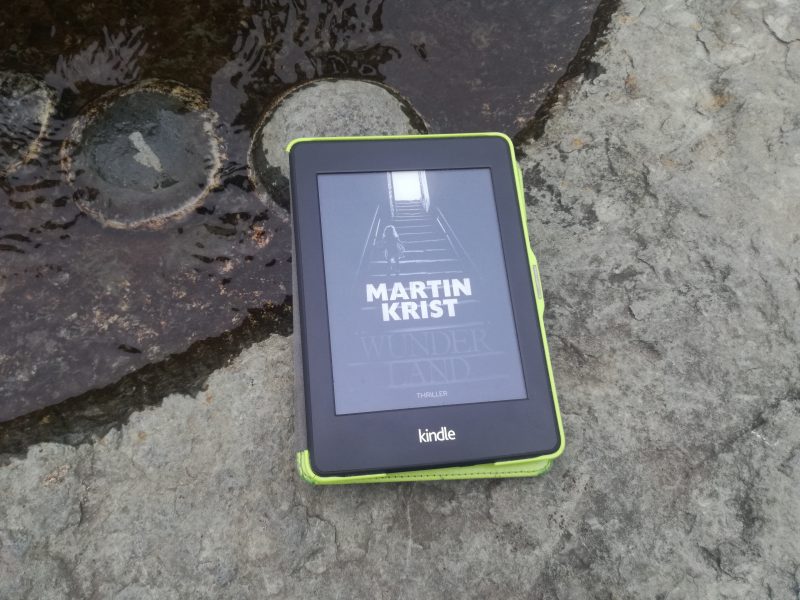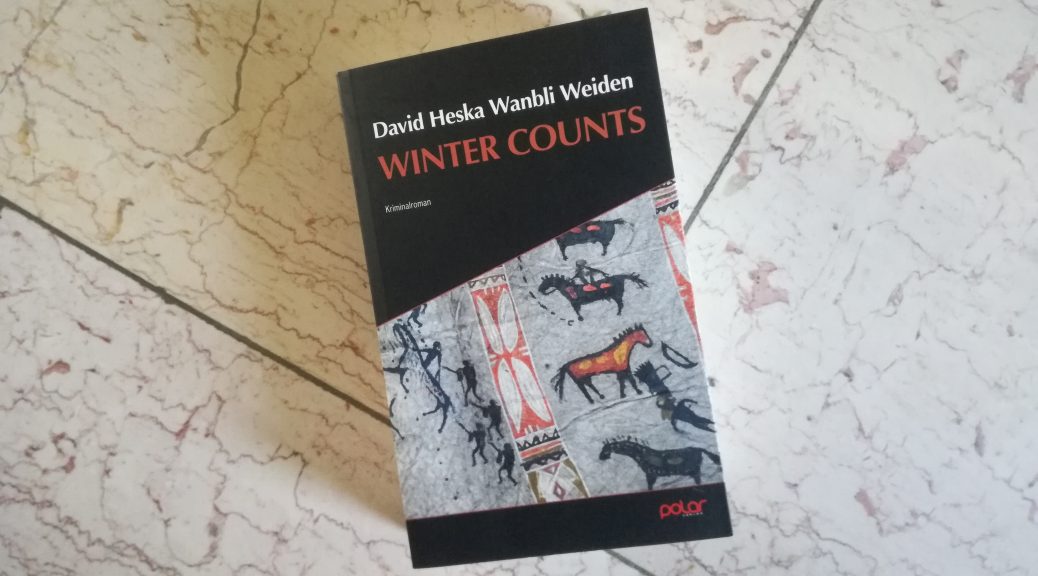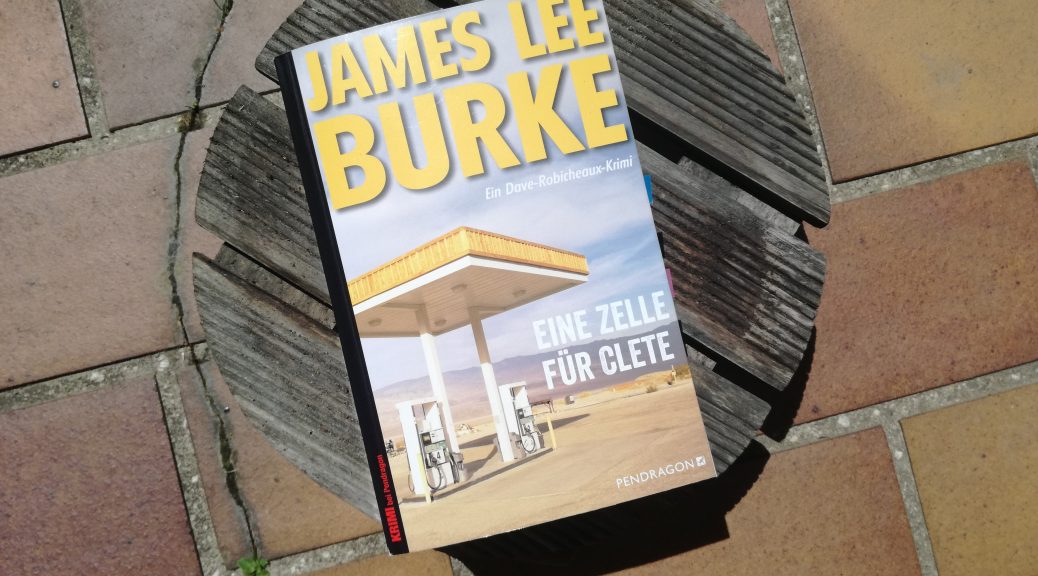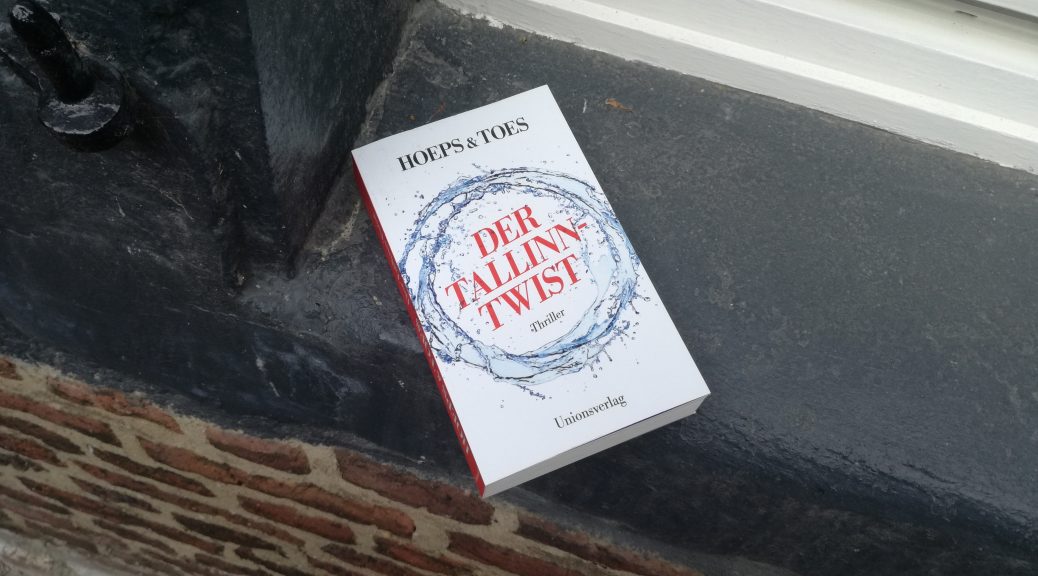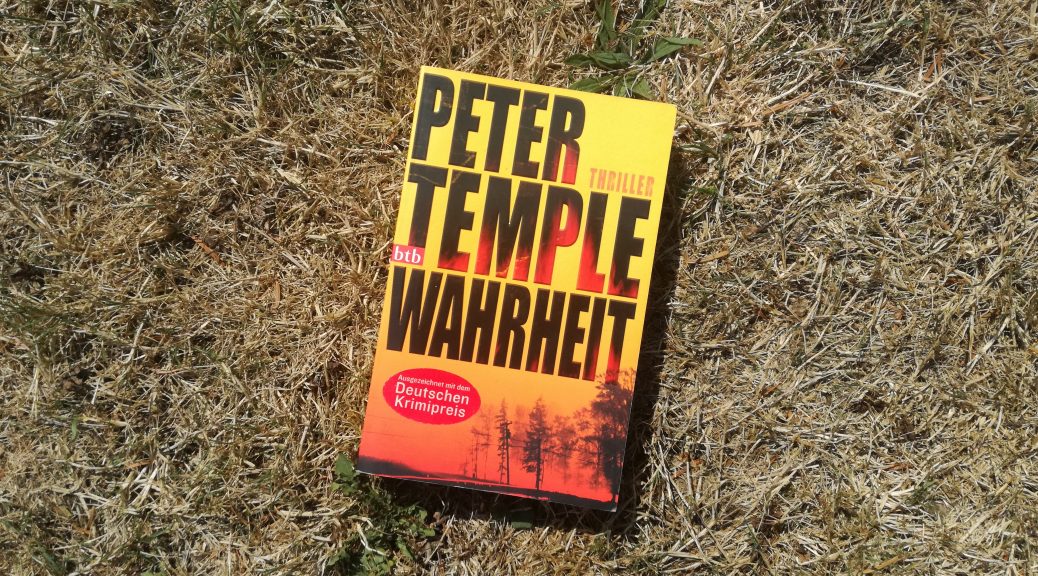
Peter Temple | Wahrheit
Als er sich zurücklehnte, den Adrenalinschub spürte, hatte er kurz das Gefühl, auf Singos Platz zu gehören: Stephen Villani, Chef des Morddezernats. Jemand, der es verdient hatte, Chef des Morddezernats zu sein.
Kurz. (Auszug S. 162)
Ich habe schon immer viel gelesen, überwiegend im Krimigenre. Seit etwa zehn Jahren als Amateurrezensent nochmal mehr als vorher. Dadurch habe ich eine gewisse Routine entwickelt, welches Buch mir denn gefallen könnte. Durch Wälzen von Vorschauen, Informationen über den Autor und Vorgängerbüchern, durch Meinungen anderer Rezensenten ist die Trefferquote dann eigentlich sehr hoch. Ich greife kaum noch zu Flops, weil ich schon vorher erahne, was mir nicht so passen könnte. Was ich auf der anderen Seite aber auch feststelle: Ich bin sehr zurückhaltend bei Superlativen geworden. Ich lese viele wirklich gute Bücher, aber dass ich die Höchstnote vergebe, kommt inzwischen sehr selten vor. In den letzten 18 Monaten nur drei Mal. Damit ich die 5 von 5 vergebe, muss inzwischen viel zusammenkommen: Setting, Figuren, Thema und ein sprachlich-literarischer Anspruch. Ich muss von Beginn an merken: Oha, hier will es der Autor oder die Autorin wissen. Und den hatte ich bei „Wahrheit“ direkt im ersten Absatz:
Sie fuhren über die West Gate Bridge, hinter Ihnen lag eine Wohnung in Altona, eine tote Frau, eigentlich noch ein Teenager, schmutzige, rot gefärbte Haare, ausgebleichte Tätowierungen, Stichverletzungen in Bauch, Brustkorb, Rücken, Gesicht, zu viele, um sie zu zählen. Dem Kind, männlich, zwei oder drei Jahre alt, hatte man den Kopf eingetreten. Überall war Blut. Auf dem Nylonteppich in Pfützen, eine Kette klebriger schwarzer Pfützen. (Auszug S.7)
Die beiden Männer, die eben an diesem grausigen Tatort waren, sind Kripochef Villani und sein Kollege Birkerts aus dem Morddezernat in Melbourne. Der grausige Doppelmord ist zwei Seiten weiter schon geklärt, aber er setzt den Ton für den weiteren Roman. Denn schon werden die Mordermittler zum nächsten Tatort gerufen. In einem Luxusapartment eines neu erbauten Hochhauskomplexes (inklusive Casino) wird die Leiche einer jungen Frau gefunden. Von Beginn an werden die Mordermittler um Stephen Villani nur unzureichend unterstützt. Die Security vor Ort ist keine Hilfe, auch bei den Vorgesetzten scheint der Fall keine Priorität zu besitzen. Da gerät ein zweiter Fall in den Fokus: In einer Gewerbeimmobilie wurden drei Kriminelle zum Teil brutal gefoltert und ermordet. Hier wird schnelle Aufklärung verlangt. Der Fall scheint eine Abrechnung im Milieu gewesen zu sein, hier ist zur Beruhigung der Bevölkerung ein rascher Erfolg vonnöten.
Nebenbei hat Inspector Villani auch privat einige Baustellen: Seine Ehe kriselt, er hat eine Geliebte, eine Journalistin eines lokalen Fernsehsenders. Seine minderjährige Tochter ist verschwunden und hängt offenbar mit Drogenabhängigen ab. Als Polizisten die Tochter aufgreifen, lässt Villani sie einige Stunden in Polizeigewahrsam schmoren und verschärft damit die familiäre Situation noch. Derweil hockt sein Vater im Hinterland auf seiner Farm, während gerade gewaltige Buschbrände toben. Villanis Versuche, ihn dort wegzulocken, sind vergeblich.
Orong winkte sie näher. Gillam und Barry neigten sich zu ihm hin.
„Ein Beispiel ist Prosilio“, sagte er und sah dabei Villani an, „man will nicht, dass irgendeine Nuttengeschichte ein Multimillionen-Dollar-Projekt beschädigt, ein Vorzeigeprojekt, ein Kronjuwel dieses Bezirks.“ […]
„Man findet jeden Tag tote Schlampen, stimmt’s, Inspector?“, sagte Orong. (Auszug S. 126)
Autor Peter Temple wurde 1946 in Südafrika geboren, arbeitete als Journalist. Er verlies bewusst 1977 das Apartheidregime, lebte einige Jahre in Deutschland und emigrierte dann 1980 nach Australien. Er arbeitete dort als Literaturdozent. Erst 1996 erschien „Bad Debts“, sein Debütroman und erster Band der vierteiligen Serie um den Privatermittler Jack Irish. Leider verstarb Temple bereits 2018 an Krebs. Er gilt aber weiterhin als einer der besten Krimiautoren Australiens. Fünfmal gewann er Australiens wichtigsten Krimipreis, den Ned Kelly Award, 2007 für „The Broken Shore“ auch als erster Australier den Gold Dagger, 2012 den Deutschen Krimipreis für „Wahrheit“. Und eigentlich reicht sein Ruf auch übers Genre hinaus, denn „Wahrheit“ ist einfach sensationell starke Literatur. In seiner Heimat gewann er mit dem Roman überraschend als Genreautor den allgemeinen Literaturpreis „Miles Franklin Award“.
Was den Roman so herausragend macht, ist das Zusammenspiel aller Zutaten. Schon allein sprachlich ist der Roman aus meiner Sicht außergewöhnlich gut, weil er dem Leser einiges abverlangt. Hier wird nichts nebenbei erklärt, keine Erklärdialoge geführt. Alles ist sprachlich höchst authentisch, verknappt, salopp, lakonisch. Die Stimmung ist düster und explosiv. Inspector Villani wird hier auf einer wahren Tour de Force begleitet, sowohl beruflich als auch privat. Dabei werden nebenbei große gesellschaftliche Probleme Australiens wie Machtmissbrauch und Korruption eingebettet und ein äußerst spannendes Bild von Polizeiarbeit gegeben. Temple bleibt aber permanent beim Protagonisten Villani und dessen Konflikten um Liebe, Ehe, Familie, das Verhältnis zum eigenen Vater und beruflich um die Loyalität im eigenen Team, das schwierige Agieren im Polizeiapparat und der Umgang mit den eigenen Leichen im Keller. Ein großartiger Roman.
Foto & Rezension von Gunnar Wolters.
Wahrheit | Erstmals erschienen 2009
Aktuell in der deutschen Übersetzung nur als E-Book verfügbar:
ISBN 978-3-641-06681-9 | 8,99 €
Originaltitel: Truth | Übersetzung aus dem Englischen von Hans M. Herzog
Bibliografische Angaben & Leseprobe
Weiterlesen: Gunnars Rezension zu Peter Temples Roman „Die Schuld vergangener Tage“