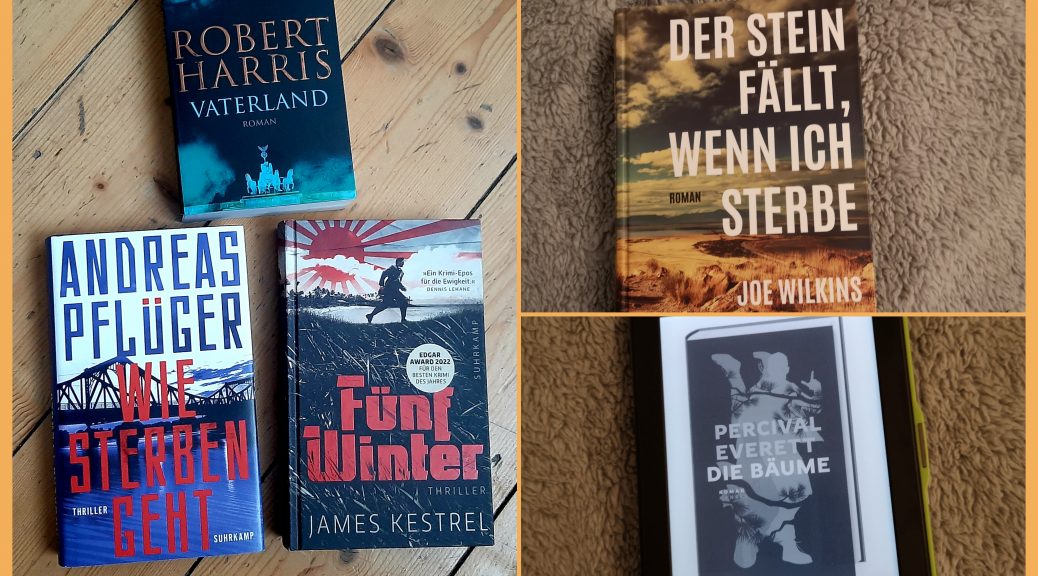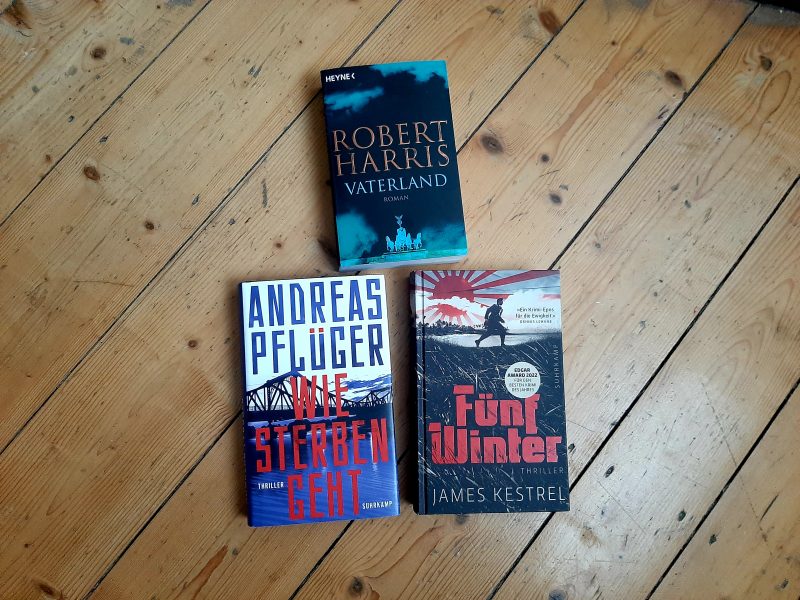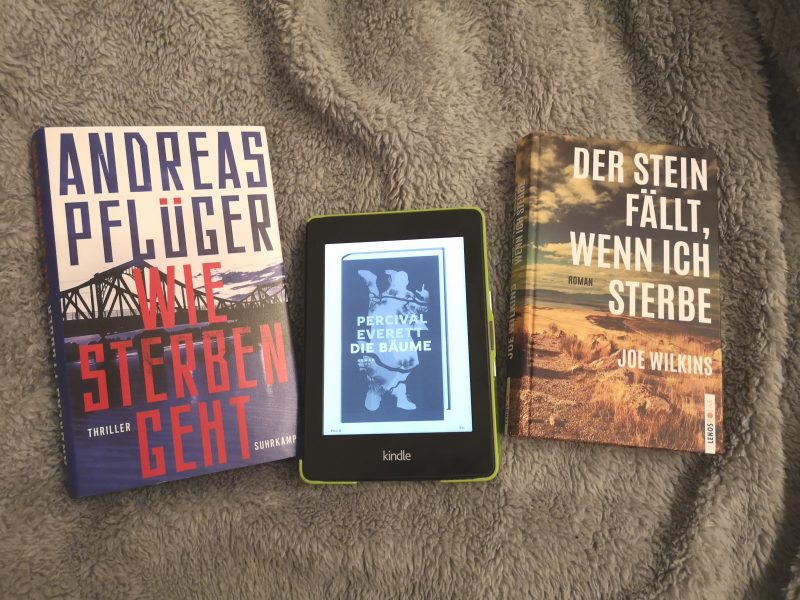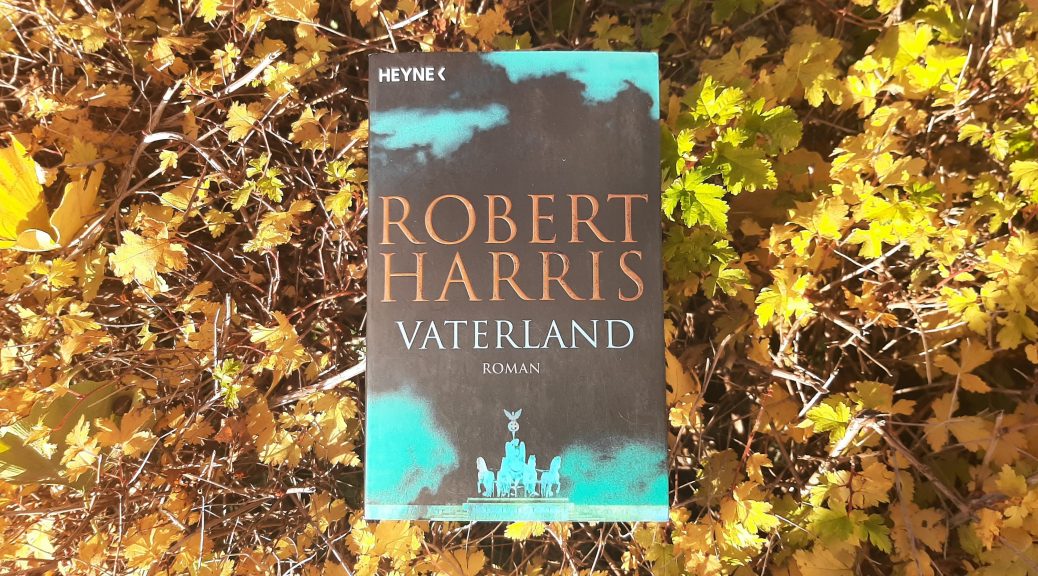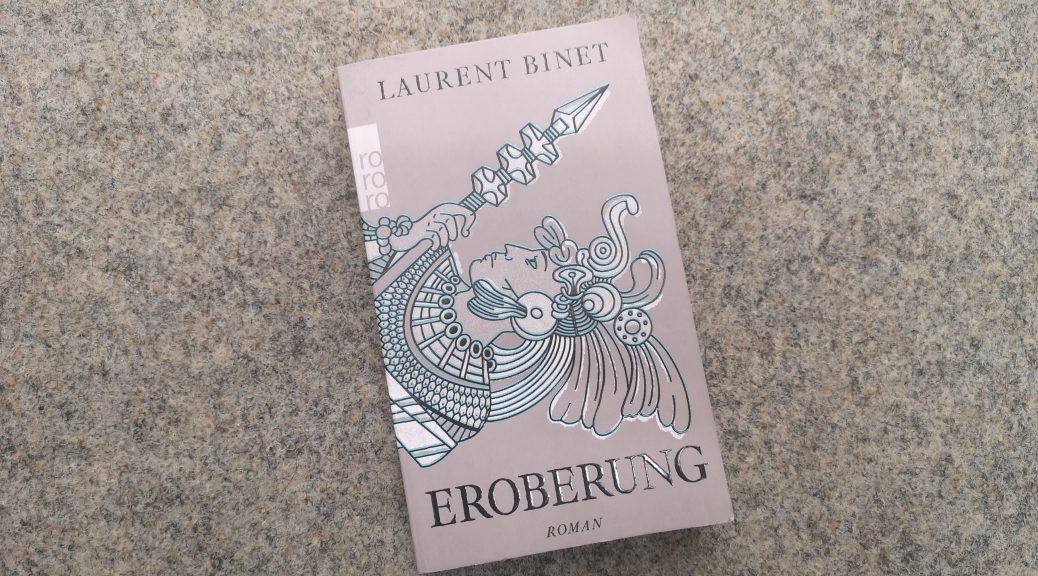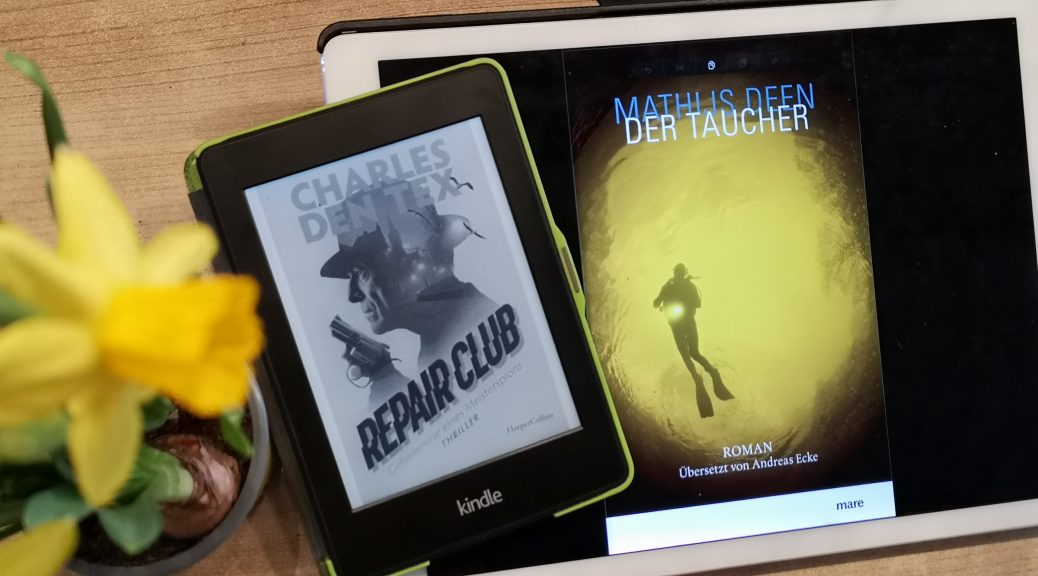
Rezensions-Doppel: Mathijs Deen | Der Taucher & Charles den Tex | Repair Club
Die niederländische und flandrische Literatur ist dieses Jahr zu Gast bei der Leipziger Buchmesse. Das ist doch mal ein gelungener Anlass für ein Rezensions-Doppel mit zwei niederländischen Autoren. Trotz der geografischen Nähe und der sprachlichen Verwandtschaft sind Übersetzungen von Krimis und Spannungsliteratur aus der niederländischen Sprache momentan nicht so häufig, wie man vermuten könnte. Wenn man sich die Liste der Gewinner des wichtigsten niederländischen Krimipreises „Gouden Strop“ der letzten zehn Jahre ansieht, so wurden lediglich zwei Romane („Staub zu Staub“ von Felix Weber und „Mutter, ich habe getötet“ von Esther Verhoek) ins Deutsche übersetzt. Das war mal anders. In den 90er und 00er-Jahren waren niederländische Krimis regelmäßiger bei deutschen Verlagen vertreten, insbesondere beim Dortmunder Grafit Verlag, der einige niederländischen Autoren wie Jac.Toes, Felix Thijssen oder Charles den Tex im Programm hatte. Letzterer ist bis heute einer der erfolgreichsten Krimiautoren der Niederlande. Mit seinem Roman „Repair Club“ wurde seit langem wieder mal ein Buch von ihm ins Deutsche übersetzt. „Der Taucher“ hingegen ist der zweite Band von Mathijs Deens Serie um den deutsch-holländischen Kommissar Liewe Cupido und offensichtlich auch wesentlich auf die deutschen Leserinnen und Leser ausgerichtet, wurde die deutsche Übersetzung doch bereits wenige Wochen vor dem niederländischen Original veröffentlicht. Zeit für eine Doppelrezension.
Mathijs Deen | Der Taucher
Ein niederländisches Bergungsboot findet an der Küste vor Amrum auf dem Echolot ein Wrack. Als sie eine Kamera ins Wasser lassen, finden sie nicht allerdings nicht nur das seit langem vermisste Schiff „Hanne“ mit wertvollem Kupfer an Bord, sondern auch die Leiche eines Tauchers, mit Handschellen angekettet an das Wrack, dadurch offensichtlich ermordet. Weil das Boot des Tauchers abgedriftet in Dänemark aufgefunden wurde, kommt die Polizei bald auf die Identität des Toten. Jan Matz wohnte auf Föhr, lebte getrennt von seiner Frau und den beiden Kindern in Wilhelmshaven und war begeisterter Wracktaucher.
Liewe Cupido ermittelt als Experte der Bundespolizei See als Verstärkung der Kriminalpolizei. Die Ermittlungen gestalten sich durchaus schwierig, denn neben dem Anhaltspunkt der illegalen Plünderung eines Wracks gibt es noch ein familiäres Drama im Hintergrund. Johnny Matz, dem 17jährige Sohn des Toten, droht eine empfindliche Jugendstrafe, weil er seinen Mitschüler Hauke Mauer angegriffen und schwer verletzt hat, sodass dieser weiterhin schwere körperliche Probleme hat. Jan Matz hat seinem Sohn falsche Alibis gegeben, die teilweise widerlegt wurden, aber die Ermittlungen und Strafverfolgung erheblich verzögerten. Darunter leidet die Familie Mauer und die Wut vergrößerte sich noch, als eines Nachts zwei Jugendliche einen Brandsatz in der Carport der Familie warfen – eine Videoaufzeichnung legt nahe, dass Johnny einer der beiden Täter war.
Wie schon in Band 1 „Der Holländer“ ist auch der Fortsetzungsband „Der Taucher“ sehr regional und maritim geprägt. Diesmal liegt der sehr überwiegende Teil der Schauplätze in Deutschland, Wilhelmshaven, Cuxhaven und Föhr, mit kurzen Abstechern in die Niederlande und nach Dänemark. Auch diesmal ist der Plot nicht spektakulär oder sonderlich actionreich, stattdessen liegt der Augenmerk stark auf den Figuren und den zerrütteten Familienverhältnissen. Die getrennte Familie Matz mit dem unkontrollierten, aufbrausenden Johnny und seinem jüngeren, sehr stillen Bruder, der auf Außenstehende zurückgeblieben wirkt, sowie die Familie Mauer, bei der neben dem Angriff auf den Sohn Hauke auch die Insolvenz des Gastronomiebetriebs des Vaters für einen Riss zwischen den Eheleuten und in der Familie gesorgt hat.
Indem er ihn diese Passage übersetzen ließ, wollte Herr Koek ihm helfen, die Tragödie zu verarbeiten, dachte Liewe, und das denkt er immer noch. Er kann sich nicht mehr genau an den Text erinnern, nur an den einen Satz: Il a été poussé, it est tombe, c’est fini. Er ist gestoßen worden, er ist gefallen, es ist aus.
Der Satz ist zu einem Mantra geworden, das er endlos wiederholt, wenn er nicht einschlafen kann. Fast jede Nacht also. Obwohl es schon besser ist, seit Vos am Fußende liegt. (Auszug Seite 97)
Zentraler Anker der Geschichte bleibt aber der Ermittler Liewe Cupido. Auf Texel aufgewachsen, deutsche Mutter, niederländischer Vater, inzwischen in Deutschland lebend und deutscher Polizeibeamter. Cupido ist ein zurückhaltender Einzelgänger, schweigsam, beharrlich, unbequem als Kollege, weil er ungern im Team arbeitet. Auch privat eher einsam, seit Band 1 wird er von der Hündin Vos begleitet, die ihm damals bei einer Observation zugelaufen ist. Aber in diesem Buch tritt auch privat jemand in sein Leben. Horizontales Element in der Reihe bislang ist der bis heute nicht vollständig verarbeitete Verlust seines Vaters. Der Vater war Fischer auf Texel und kam von einem Auslaufen nicht mehr nach Hause, in rauer See von Bord gegangen, ein tragischer Unfall. Doch Cupido trägt dieses Kapitel noch immer mit sich.
Mit „Der Taucher“ hat der niederländischen Autor und Rundfunkproduzent Mathijs Deen einen wirklich gelungenen Fortsetzungsband geschrieben. Regional und maritim verwurzelt, mit einer melancholischen, entschleunigten Grundstimmung, stimmigen Figuren und deren Verhältnissen zueinander sowie einer interessanten Wendung und Auflösung, die an dieser Stelle nicht gespoilert werden sollte. Für Freunde des gepflegten literarischen Ermittlerkrimis ist diese Reihe unbedingt zu empfehlen, der dritte Teil erscheint dieser Tage.
Charles den Tex | Repair Club
John Antink ist ehemaliger Chef des niederländischen Geheimdienstes. Inzwischen 70 und im Ruhestand betreibt er mit drei Freunden ehrenamtlich einen „Repair Club“, in dem alte Haushaltsgeräte repariert werden. Bei einem dieser Termin steht plötzlich ein Mann, vermeintlich ein Russe, mit einer alten Robotron-Schreibmaschine aus DDR-Zeiten vor ihm und bedroht ihn mit einer Waffe. Er gibt John einen Hinweis auf eine alte Geheimdienst-Akte und nennt ihm einen neuen Termin für ein erneutes Treffen.
Währenddessen ist die neue Chefin des Geheimdienstes, Alisha Calder, unter starken Druck geraten. Durch ein Leak ist an die Öffentlichkeit geraten, dass mit Mitteln des Geheimdienstes offenbar eine syrische Terrorgruppe finanziert wurde. Calder braucht ihren Vorgänger John Antink, um dieses undurchsichtige Manöver zu durchschauen, denn die Mittel kommen offenbar tatsächlich vom Geheimdienst, nur wusste niemand etwas. John Antink kommt schnell der Verdacht, dass beide Ereignisse zusammenhängen. Er begibt sich tief in die alten Akten und durchleuchtet seine Vergangenheit als Spion, die ihn unter dem Deckmantel als schweizer Finanzdienstleister in die DDR der späten 1980er gebracht hat. Die Dinge spitzen sich zu, als Antinks Frau Vera fast von Russen entführt wird und der russische Mann aus dem Repair Club tot aufgefunden wird.
„Jemand will mich nach draußen locken. Mit dieser Akte. […] irgendwo in dieser Akte muss etwas stehen, ein Hinweis oder etwas anderes, irgendwas, was sie wissen oder haben wollen.“ Davon ist John überzeugt. Jemand will ihn aufscheuchen und in die Vergangenheit schicken, damit er dort etwas findet, was nur er finden kann. Etwas, was jemand verloren hat. (Auszug E-Book Pos. 2097)
Wer beim ersten Blick auf den Klappentext und den Titel des Romans gedacht hatte, hier geht es in die Richtung „Der Donnerstagsmordclub“ mit rüstigen und schrulligen Rentnern, den muss ich leider enttäuschen. John Antink ist zwar verrentet, aber die Probleme des Alterns kommen nur ab und an vor und seine Kollegen vom Repair Club spielen nur Nebenrollen. Aber ein Spionageroman aus den Niederlanden ist doch auch mal was Neues und die Story ist auch ziemlich modern. Es geht um den Clash zwischen der modernen, digitalen Geheimdienstarbeit von Calder und der altgedienten Methoden von Antink, der noch gerne im Außeneinsatz und mit Körpereinsatz die Dinge erledigt (aber nicht unterschätzt werden sollte). Übergeordnet geht es aber vor allem um russische Einflussnahme in Westeuropa und den Versuch, den Geheimdienst eines NATO-Landes zu desavouieren. Die Spur führt Antink schließlich in seine Vergangenheit und ins Jahr 1988 nach Dresden. Und dreimal dürft ihr raten: Welche junge, vielversprechende Mann war damals KGD-Statthalter vor Ort?
Durchaus gute Zutaten für einen guten Spionagethriller. Doch jetzt kommt leider das große Aber, was mich selbst sehr überrascht. Den Tex wählt aus meiner Sicht nicht die richtige Erzählperspektive aus. Ein allwissender Erzähler wacht über den Text und plaudert den Leser an vielen Stellen völlig zu. Alle Einblicke, alle Gedanken, alle Erklärungen werden mitgeteilt. Auch die Rückblenden werden nicht nacherlebt, sondern vorwiegend nacherzählt. Das macht die Spannungskurve ziemlich zunichte und hinterlässt eine Spur von Langeweile und Frustration bei mir. Umso mehr, weil ich weiß, dass den Tex es anders kann. Zwei Romane habe ich bislang von ihm gelesen („Die Zelle“ und „Die Macht des Mr. Miller“) und beide waren plotgetriebene Thriller mit hohem Spannungsfaktor, die im Großen und Ganzen gut bis prächtig unterhielten. Hier hingegen verplempert der Autor für meinen Geschmack seine guten Ploteinfälle, weil der Erzähler eine Quasselstrippe ist. „Show, don’t tell“ heißt doch eigentlich das Zauberwort für den guten Thrillerautor. Leider von den Tex hier nicht beherzigt. Zum Ende wird es besser, einen schönen Plottwist inklusive, aber trotzdem war hier deutlich mehr drin.
Foto & Rezension von Gunnar Wolters.
Der Taucher | Erschienen am 14.02.2023 im Mare Verlag
ISBN 978-3-86648-701-7
320 Seiten | 22,- €
Originaltitel: De duiker | Übersetzung aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Bibliografische Angaben & Leseprobe
Wertung: 4 von 5
Kriminalroman
Repair Club | Erscheinen am 20.02.2024 bei HarperCollins
ISBN: 978-3-36500-610-8;
496 Seiten | 14,- €
Originaltitel: De repair club | Übersetzung aus dem Niederländischen von Simone Schroth
Bibliografische Angaben & Leseprobe
Wertung: 3 von 5
Spionageroman
Weiterlesen: Vier Rezensionen aus unserem Minispecial „Ein langes Wochenende mit Spannungsliteratur aus Flandern und den Niederlanden„