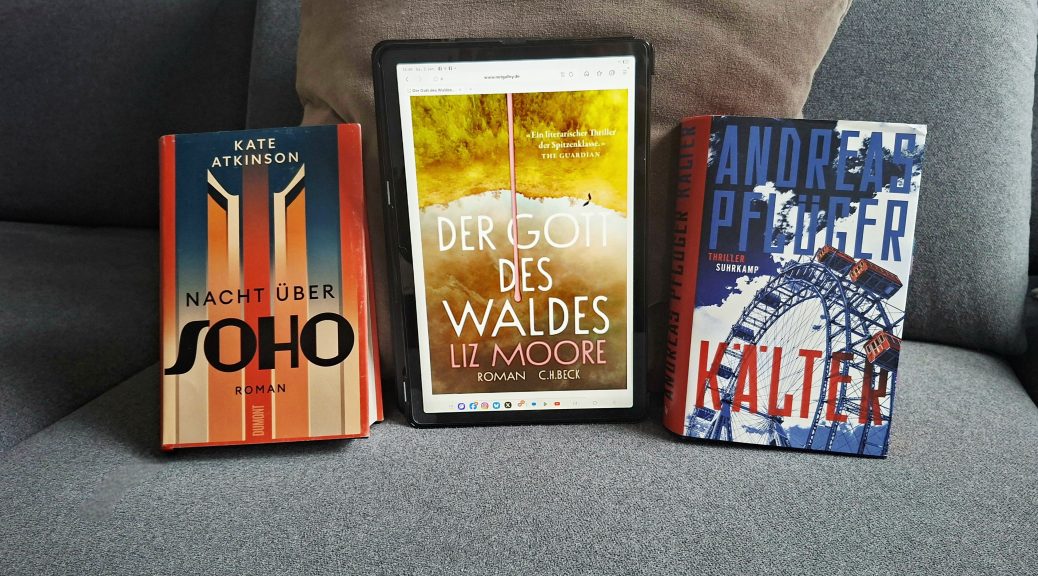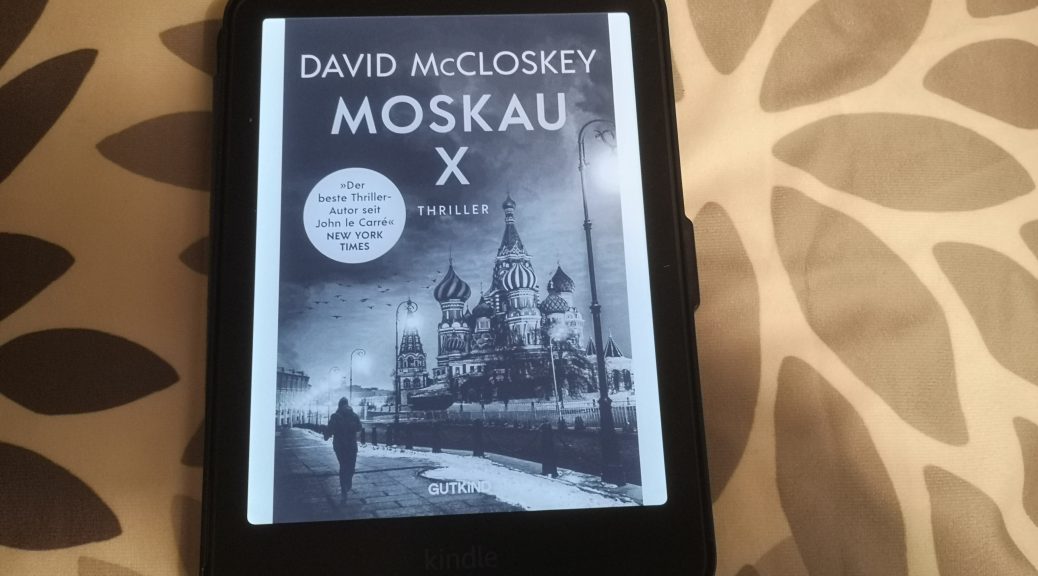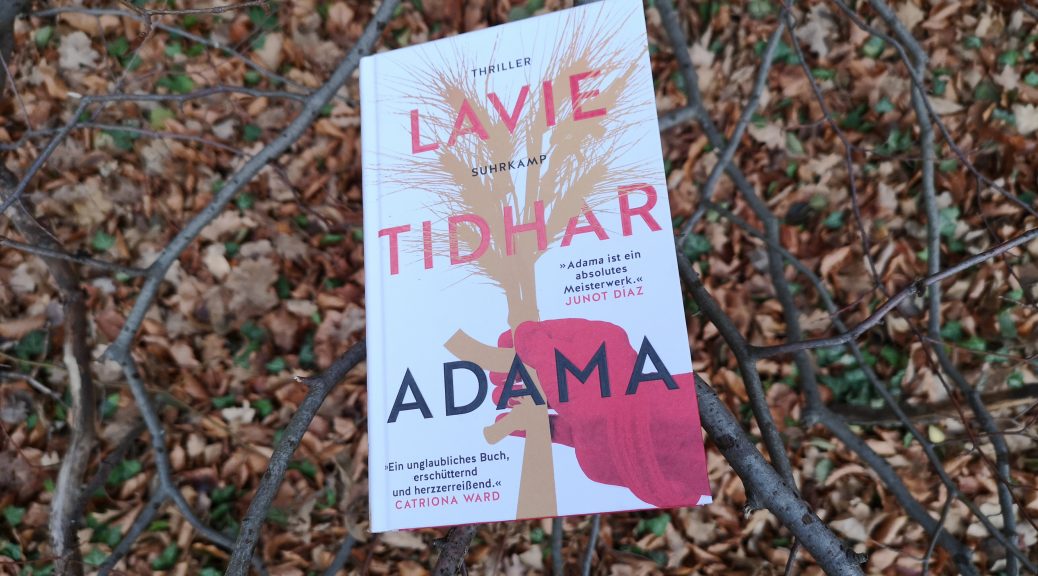Doug Johnstone | Schwarze Herzen (Band 4)
Autoren und Autorinnen haben ja oft eine enge Beziehung zu ihren Figuren und tun sich teilweise schwer, diese loszulassen. So ähnlich muss es auch Doug Johnstone ergangen sein, denn er hatte ursprünglich die Idee, die Reihe um die Skelfs-Frauen als Trilogie anzulegen. Und tatsächlich ging im dritten Band die übergreifende Story um den psychopathischen Craig zu Ende. Vermeintlich. Aber Johnstone konnte offensichtlich nicht von seinen drei ungewöhnlichen Frauen Dorothy (Großmutter/Mutter), Jenny (Tochter/Mutter) und Hannah (Tochter/Enkelin) lassen, die als Familienunternehmen ein Bestattungsinstitut und eine Privatdetektei führen. In der Heimat ist bereits Band 6 erschienen, in deutscher Übersetzung nun Band 4.
Wie eben angedeutet (Vorsicht Spoiler!), kam es zuletzt zu einem Showdown zwischen Jenny und ihrem Ex Craig. Zugunsten von Jenny, die aber dennoch in ein großes Tief gefallen ist, sich dem Alkohol zuwendet und ihren Therapeuten verführt, anstatt die Therapie ernst zu nehmen. Dass nun scheinbar nach langer Zeit Craigs Leiche aus dem Meer wieder aufgetaucht ist, macht die Sache nicht wirklich besser, denn nun kommt Craigs Familie plötzlich wieder hervor und Craigs Schwester Stella lässt Jenny ihre Tat in Notwehr nicht so einfach durchgehen. Währenddessen hat Dorothy zwei schräge Fälle aufgetan: Eine Frau wird beerdigt, ihr Ehemann wird vermisst. Der Sohn verdächtigt den Onkel und beauftragt Dorothy, seinen Vater zu finden. Der zweite Fall ist der eines alten japanischstämmigen Mannes, der nach dem Tod seiner Frau einen Schrein für sie zuhause angelegt hat und nun glaubt, von ihrem Geist angegriffen zu werden. Hannah hingegen hat plötzlich eine Kommilitonin, die sie stalkt und sich zwischen sie und ihre Frau Indy drängt – und offenbar mehrere Tage in der gleichen Wohnung mit ihrer verstorbenen Mutter gewohnt hat.
Dorothy kämpfte mit den Klavierriffs im Mittelteil und dachte dabei an Eddie. Inzwischen würde seine Leiche neben Craig in der Leichenhalle liegen. Sie dachte an Violet, die ihren Sohn verloren hatte. Sie dachte an Hannahs Stalkerin, deren Mum plötzlich gestorben war. Udo, der von seiner Frau heimgesucht wurde. Es war ein Kaleidoskop aus Leben und Tod, ein Spinnrad von Kummer und Leid, verwirrend und beunruhigend. (Auszug S. 200)
Die Skelfs-Reihe ist einer der aktuell ungewöhnlichsten Krimireihen. Drei Generationen von Frauen, die zwei außergewöhnliche Berufe miteinander verbinden. Über die ganze Reihe schreibt Doug Johnstone abwechselnd aus ihren Perspektiven, dringt tief in die Figuren ein. Der Leser spürt die Emotionen der Protagonistinnen sehr direkt, erfährt viel über ihre Stärken und ihre Schwächen. In diesem Band befindet sich vor allem Jenny gerade auf einem absoluten Tiefpunkt. Durch diese Konstruktion ist diese Reihe aber auch eine derjenigen, wo es absolut nicht zu raten ist, die Bände isoliert zu lesen. Diese Reihe baut viel zu sehr aufeinander auf und als Leser würde man sich auch der ganzen Feinheiten berauben.
„Schwarze Herzen“ setzt die Reihe in einem gesetzteren Ton fort, der Vorgänger war ungewohnt spannend und actionreich. Der Autor zeigt aber, dass damit noch kein endgültiger Abschluss gefunden wurde. Trauer, Tod und Schuld spielen immer eine große Rolle in dieser Reihe – und Johnstone weiß dem Thema auch im vierten Band neue Facetten und auch Skurrilitäten (oder wunderbare Details wie dem „Windtelefon“) abzuringen. Auch das andere große Thema dieser Reihe spielt natürlich wieder eine große Rolle: Familie und Freundschaft, die Trost und Geborgenheit spenden, aber auch Arbeit und Kommunikation bedürfen. Und auch wenn es dieses Mal spannungstechnisch etwas gedämpfter zugeht, die Reihe behält ihren großen Charme. Doug Johnstone bringt an gewissen Stellen Humor an und auch Edinburgh, Musik und Astrophysik (unverkennbar die Schwächen des Autors als Dundiner, Schlagzeuger und Physiker) kommen angemessen zur Geltung. Eine tolle Reihe mit wunderbaren Figuren und tiefgründigen Themen, der ich gerne weiter treu bleibe.
Foto und Rezension von Gunnar Wolters.
Schwarze Herzen | Erschienen am 15.11.2025 im Polar Verlag
ISBN 978-3-910918-36-8
340 Seiten | 26,- €
Originaltitel: Black Hearts | Übersetzung aus dem schottischen Englisch von Jürgen Bürger
Bibliografische Angaben & Leseprobe
Weiterlesen: Gunnars Rezension zu Band 2 und Kurzrezension zu Band 1