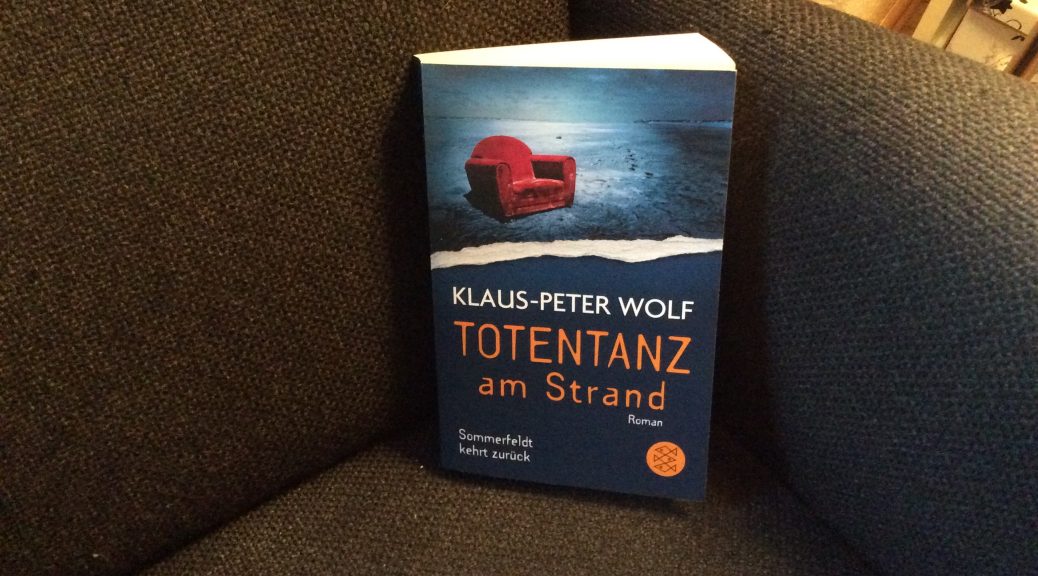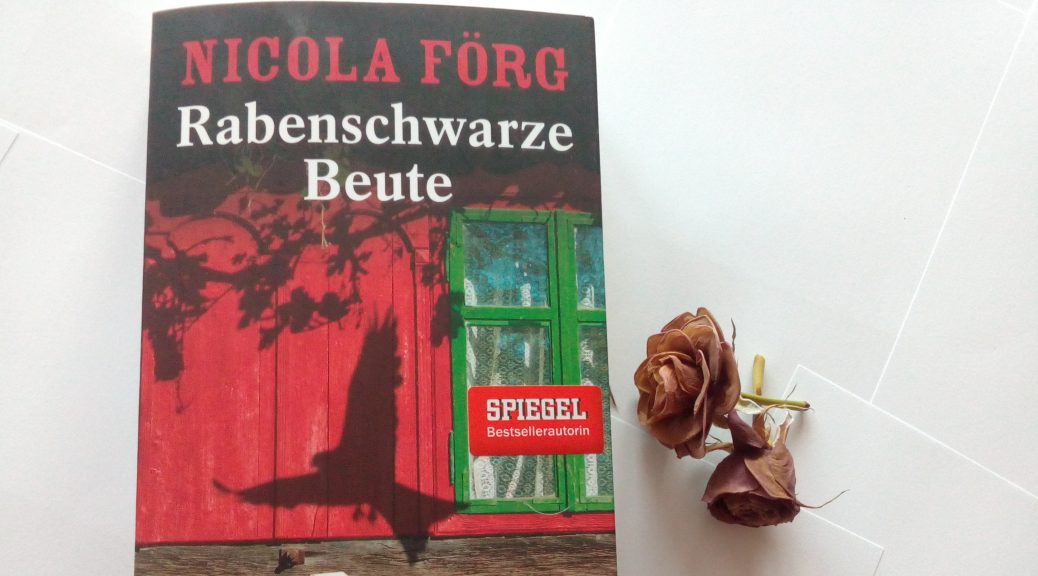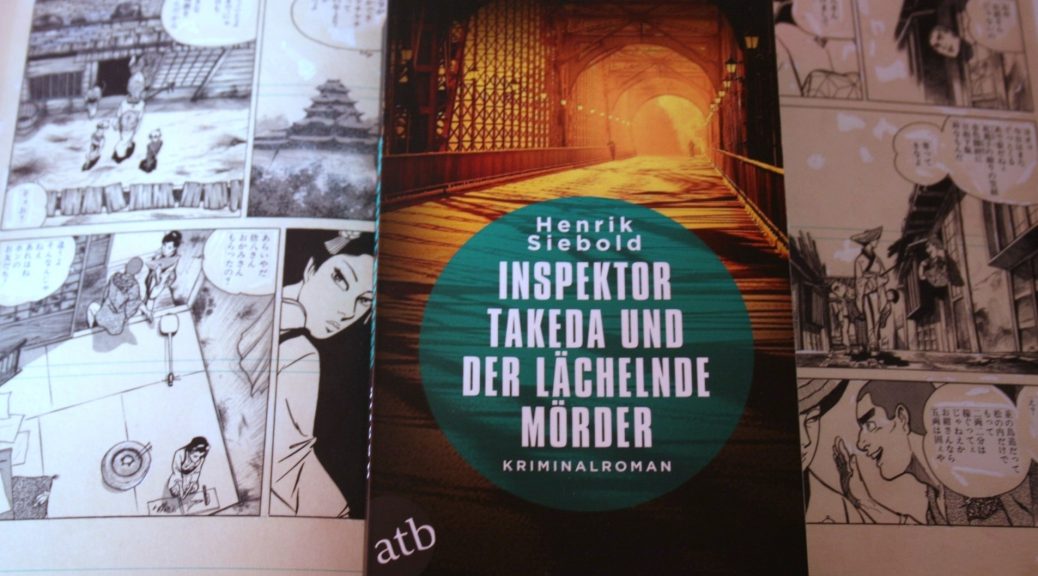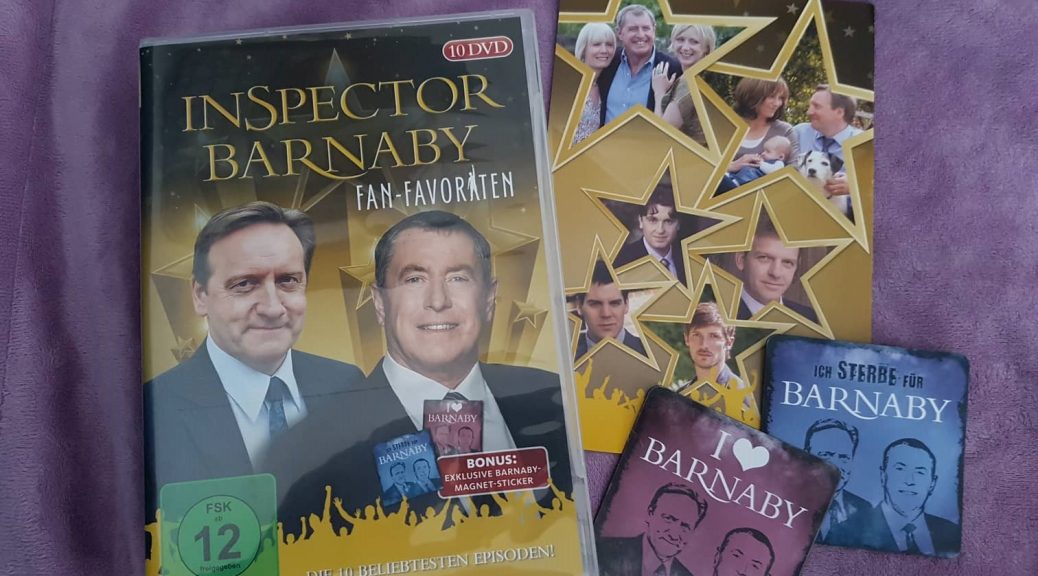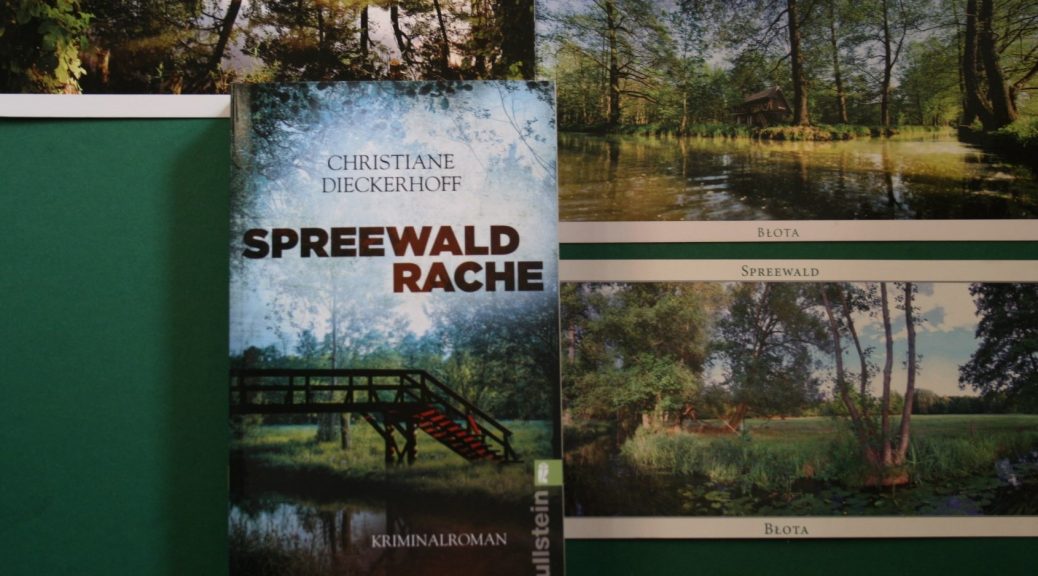
Christiane Dieckerhoff | Spreewaldrache Bd. 3
Die Polizeibeamten des Lübbener Reviers finden sich bei einer teambildenden Maßnahme wieder. Ihr Chef hat sie zum Wursten in eine kleine Metzgerei geschickt, die von den Geschwistern Schenker am Rand des Hochwalds direkt am Ufer der Spree geführt wird. Seit PH, sein Vorname ist das bestgehütete Geheimnis des Reviers, einen Lehrgang über Mitarbeiterführung besucht hat, gehören solche Aktionen zu seinem Leitungskonzept, was bei den Untergebenen auf wenig Gegenliebe stößt. Zum Glück muss die aktuelle Unternehmung bald abgebrochen werden, denn ein junger Mann ist niedergeschlagen worden, ausgerechnet Daniel, der Sohn von Jana Schenker. Also nehmen Klaudia Wagner und Frank Demel die Ermittlungen auf.
Daniel ist Spross einer Familie, die früher ebenso wie viele Alteingesessene aus Kahnbauern und -führern bestand, ein Geschäft, aus dem sie nach und nach durch unsaubere Machenschaften der Klingebiels gedrängt wurden. Auch mit kriminellen Methoden? Mario Schenker spricht von Mord, offiziell war der Zwischenfall im Jahr 1993 allerdings ein Unfall, bei dem Daniels Zwillingsbruder ums Leben kam, er verbrannte, als ein Kahnschuppen der Klingebiels abgefackelt wurde. Seitdem herrscht Krieg zwischen den beiden Familien.
Die Beerdigung des alten Klingebiel ist es, die nun die aktuellen Verwicklungen in Gang setzt, weil plötzlich lange verschwundene Familienmitglieder auftauchen und alte Wunden aufbrechen. Warum aber Daniel angegriffen wurde, von wem, warum, niemand weiß es. Auch das Opfer selbst hat keine Ahnung, wer ihn da hinterrücks niederschlug, während er durch das Fenster der Datsche spähte, in der sich sein Vater eingenistet hat. Der heißt Frank Klingebiel und bei der Beerdigung hat er ihn zum ersten Mal gesehen, denn seit 1993 war er abgetaucht, nachdem er ausgerechnet die damals fünfzehn Jahre alte Jana Schenker geschwängert hatte. Nun überrascht ihn Daniel bei einem Rendezvous, aber er kann die Frau nicht erkennen, die da mit ihm zusammen ist.
Daniel gerät überflüssigerweise in den Fokus, er, der eigentlich mit seiner Gehirnerschütterung im Bett liegen sollte, ist ständig präsent und stolpert durch die Geschichte, obwohl er nichts zur Klärung der verwirrenden Umstände beitragen kann. Seine Hauptrolle verdankt er lediglich der Tatsache, dass er den übrigen Figuren als Dialogpartner dient. Bald darauf wird in einer Datsche neben dem ersten Tatort ein Toter entdeckt, erschlagen mit einem Holzscheit. Es handelt sich um einen Obdachlosen, der seit einiger Zeit in der Gegend gesehen wurde. PH fasst die Tatsachen zusammen: „Daniel Schenker ist der Sohn von Frank Klingebiel, welcher der Sohn von Fritz Werheid ist, der wahrscheinlich mit dem gleichen Stück Holz erschlagen worden ist, mit dem auch sein Enkel eins über den Schädel bekommen hat“.
Ja, die Handlung ist sehr unübersichtlich, das verwickelte Personengeflecht zwischen den beiden verfeindeten Sippen klärt sich nur sehr langsam und die wahren Beziehungen und Verwandtschaftsverhältnisse werden nur zögerlich offengelegt, so dass die Lektüre große Aufmerksamkeit erfordert (selbst die Autorin kommt an einer Stelle mit den Namen durcheinander) und ebenso viel Geduld, um dem zähen Plot mit seinen Schleifen und Kehren zu folgen. „Sie wiederholte ihre Gedanken wie ein Mantra“ heißt es an einer Stelle und an anderen „und täglich grüßt das Murmeltier“, und genau dieses Gefühl hat leider der Leser dieser Soap-Opera.
Dabei hat Dieckerhoff eigentlich ein sehr angenehmen, flüssigen, lockeren Schreibstil, gut zu lesen, wenn da nicht ein paar störende Marotten wären. So etwa muss sich der Leser sowohl mit ständigen Handlungssprüngen anfreunden, 78! Kapitel auf knapp 300 Seiten lassen erahnen, wie hektisch hier völlig unnötig die Perspektive gewechselt wird, als auch ermüdende, zum Teil fast wörtliche Wiederholungen ganzer Absätze ertragen und, zu allem Überfluss, sogar Zusammenfassungen zur Erinnerung an das, was bisher geschah. All das lässt nicht wirklich Kontinuität zu.
Mehrere Rückblenden in das Jahr 1993 schildern auch nur das, was wir sowieso schon wissen, und dass Klaudia die alten Akten aus dem Archiv zieht, bringt ebenso keine neuen Erkenntnisse: Es gab ein Feuer, in dem Marco Schenker umkam, und es gab eine Anzeige gegen Frank Klingebiel wegen seines Verhältnisses mit einer Minderjährigen, die aber bald zurückgezogen wurde.
Klaudia erhofft sich Einblicke in das innere Gefüge der Dorfgemeinschaft und die besonderen Verflechtungen und Verwicklungen von Schiebschick, dem alten Fährmann. Er kennt den Ort und seine Menschen wie kein Zweiter, er kennt auch die Geschichte und die Geschichten, weiß von alten Gerüchten und neuen Verdächtigungen, aber er will so recht nicht heraus mit der Sprache. Einige alte Spreewaldbewohner sprechen noch Sorbisch, so auch Schiebschick. Leider kennt er nur ein einziges Wort, er nennt Klaudia penetrant „holca“, was auf Obersorbisch einfach „Mädchen“ bedeutet und Klaudia gar nicht gefällt. Ansonsten beschränkt sich seine individuelle Ausdrucksweise auf die Floskel „wa“, die er an jede zweite Aussage anhängt.
Spreewald-Atmosphäre entsteht lediglich, wenn Klaudia sich mal einen Gurken-Lutki gönnt oder ab und zu ein Babbenbier getrunken wird. Das ist natürlich ein Bisschen wenig Lokalkolorit, die zauberhafte Landschaft (Das Coverfoto gehört mit zum Besten dieses Buchs) wird auch nicht angemessen gewürdigt, Dieckerhoffs Spreewald ist herbstlich, und das heißt bei ihr immer nebelig. Nebelfetzen, die im Wind zerreißen, sind ihre liebste Naturschilderung, man sieht den Wald vor lauter Nebel nicht, leider. Landschaftsmalerei oder Milieustudien, die prächtige Kulisse in Szene zu setzen ist nicht die Sache der Autorin. Und Personenbeschreibung? Über das Äußere der Figuren gibt es nur sehr spärliche oder gar keine Aussagen, so dass sich der Leser sein vollkommen eigenes Bild machen muss. Zu einer der interessantesten und sympathischsten Gestalten des Romans etwa, dem ollen Fährmann, heißt es lediglich, dass er „wässrige Altmänneraugen“ habe, „wasserblaue Altmänneraugen“, einen „tränenden Altmännerblick“ und, wie gesagt, „wässrige Altmänneraugen“. Dieses Bild hält die Autorin für so gelungen, dass sie uns damit ständig auf die Nerven geht.
Und mit einigen anderen haarsträubenden Sprachbildern wie „Das Schweigen breitete seine Schwingen zwischen ihnen aus“, „Die Lüge floss wie ein öliger Film über den Tisch“, „Die Frage platzte wie eine Seifenblase von ihren Lippen“, „Die Erkenntnis fiel ihr wie Schuppen aus den Haaren“, „Er musterte sie wie eine schiefe Fuge“, und so weiter, und so weiter. Schiefe Vergleiche, „platt wie ein Schnitzel“ sagt selbst Dieckerhoff. Höhepunkt: „Der oder die Träger slash in“, der größte Blödsinn, den ich je gehört oder gelesen habe im Bemühen um geschlechtergerechte Ausdrucksweise, und es gibt eine Menge unsinniger, verkrampfter Versuche Genderneutralität zu wahren. Klaudia benutzt diese Formulierung bei einer der regelmäßigen Lagebesprechungen auf dem Revier, bei denen es allerdings ebenso regelmäßig nicht viel zu besprechen gibt, es gibt Erkenntnisse und keine Ergebnisse, die Lage ist bis zur plötzlichen, eher zufälligen Aufklärung reichlich unübersichtlich.
Mehr Wert legt Dieckerhoff auf die Offenlegung des Innenlebens ihrer Figuren, das gelingt viel besser, so dass der Leser einen guten Eindruck vom Charakter der handelnden Personen bekommt. Gefühle werden nach Außen gekehrt, Emotionen wie Verzweiflung, Verbitterung, Liebe, aber auch Feindseligkeit oder gar Hass. Das gegenseitige Misstrauen ist groß, aber ein klares Motiv für die beiden Taten können die Ermittler nicht ausmachen. Klaudia und Demel sind ratlos, drehen sich bei ihren Ermittlungen im Kreis und betreiben blinden Aktionismus statt gesicherten Spuren nachzugehen, besuchen diesen, befragen jenen, reden mit jedem einzelnen und anschließend noch einmal aufs Neue mit allen Beteiligten ohne von irgend jemand irgend etwas zu erfahren. Alle ahnen etwas und alle verschweigen die Wahrheit oder haben Angst vor ihr und so entwickelt sich die Geschichte nicht, sie tritt über viele Kapitel auf der Stelle.
Dazu gibt es immer wieder Kunstpausen, die den Handlungsfaden abschneiden, der erst nach einigen Irrungen und Wirrungen wieder aufgenommen wird, was dem Lesefluss nicht dienlich ist und die Spannung eben nicht steigert. Dieckerhoff unterbricht sogar häufig den Dialog, um ihn nach längeren Einschüben wieder aufzunehmen, auch diese Angewohnheit ist eher anstrengend.
Wer wie ich mit Spreewaldrache, dem dritten Band, in die Serie einsteigt, wird ziemlich spärlich versorgt mit Informationen über persönliche Hintergründe und Entwicklungen der wichtigsten Beteiligten. Wenn schon Andeutungen über Geschehnisse aus der Vergangenheit der Serienfiguren, dann nicht einfach im Raum stehen lassen sondern besser weglassen oder noch besser die Vorgeschichte kurz erläutern und nicht als Rätsel präsentieren. Der Leser muss in diesem Buch ohnedies viel mitdenken oder sich das eine oder andere denken, das nicht gesagt oder geschrieben wird, jedenfalls nicht da, wo es nötig wäre für ein besseres Verständnis des Plots und einen einigermaßen komfortablen Lesefluss. Auch Nebenhandlungen mit aktuellen persönlichen Problemen und familiären Tragödien der Hauptfiguren werden lediglich angesprochen und nicht weitererzählt. Kollege Thang Rudnik fällt in dieser Folge aus, er gibt sich die Schuld am Selbstmordversuch seiner Frau, Klaudias Vater liegt nach einem Schlaganfall auf der Stroke Unit und nach einem Zerwürfnis mit ihrem Kollegen und Vermieter Uwe wird sie wohl nicht mehr mit ihm und seiner Tochter unter einem Dach wohnen.
Das Ende ist unbefriedigend, das Ergebnis offen, es zeigen sich bedauerlicherweise auch logische Schwächen. „Kann sein“ heißt es da oder „möglich“, und tatsächlich, nach allem, was man nun weiß, sind mehrere Szenarien denkbar, auch wenn der Leser schließlich eine Ahnung hat, wie es tatsächlich gewesen ist.
Richtig ärgerlich ist aber zum schlechten Schluss ein Epilog, der völlig überflüssig ist und gar nichts zur Geschichte beiträgt, purer Effekt um neugierig zu machen auf den folgenden Roman um Klaudia, Thang und Demel.
Ich bin darauf überhaupt nicht gespannt!
Rezension und Foto von Kurt Schäfer.
Spreewaldrache | Erschienen am 6. April 2018 bei Ullstein
ISBN 978-3-548-28951-9
304 Seiten | 10.- Euro
Bibliografische Angaben & Leseprobe